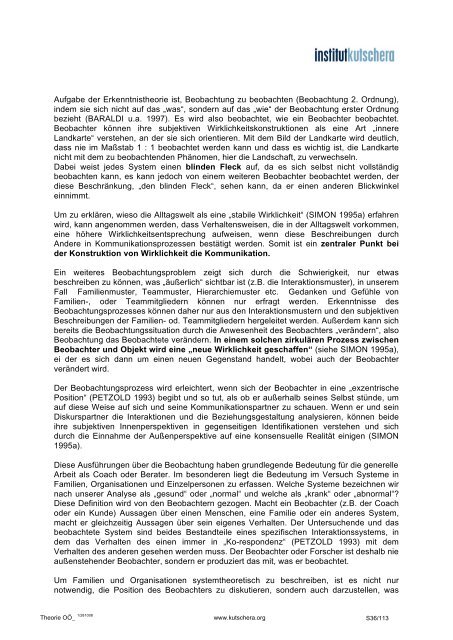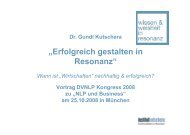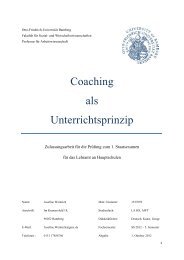Theorie Sozialkompetenz in der Resonanzmethode - Institut Kutschera
Theorie Sozialkompetenz in der Resonanzmethode - Institut Kutschera
Theorie Sozialkompetenz in der Resonanzmethode - Institut Kutschera
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Aufgabe <strong>der</strong> Erkenntnistheorie ist, Beobachtung zu beobachten (Beobachtung 2. Ordnung),<br />
<strong>in</strong>dem sie sich nicht auf das „was“, son<strong>der</strong>n auf das „wie“ <strong>der</strong> Beobachtung erster Ordnung<br />
bezieht (BARALDI u.a. 1997). Es wird also beobachtet, wie e<strong>in</strong> Beobachter beobachtet.<br />
Beobachter können ihre subjektiven Wirklichkeitskonstruktionen als e<strong>in</strong>e Art „<strong>in</strong>nere<br />
Landkarte“ verstehen, an <strong>der</strong> sie sich orientieren. Mit dem Bild <strong>der</strong> Landkarte wird deutlich,<br />
dass nie im Maßstab 1 : 1 beobachtet werden kann und dass es wichtig ist, die Landkarte<br />
nicht mit dem zu beobachtenden Phänomen, hier die Landschaft, zu verwechseln.<br />
Dabei weist jedes System e<strong>in</strong>en bl<strong>in</strong>den Fleck auf, da es sich selbst nicht vollständig<br />
beobachten kann, es kann jedoch von e<strong>in</strong>em weiteren Beobachter beobachtet werden, <strong>der</strong><br />
diese Beschränkung, „den bl<strong>in</strong>den Fleck“, sehen kann, da er e<strong>in</strong>en an<strong>der</strong>en Blickw<strong>in</strong>kel<br />
e<strong>in</strong>nimmt.<br />
Um zu erklären, wieso die Alltagswelt als e<strong>in</strong>e „stabile Wirklichkeit“ (SIMON 1995a) erfahren<br />
wird, kann angenommen werden, dass Verhaltensweisen, die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Alltagswelt vorkommen,<br />
e<strong>in</strong>e höhere Wirklichkeitsentsprechung aufweisen, wenn diese Beschreibungen durch<br />
An<strong>der</strong>e <strong>in</strong> Kommunikationsprozessen bestätigt werden. Somit ist e<strong>in</strong> zentraler Punkt bei<br />
<strong>der</strong> Konstruktion von Wirklichkeit die Kommunikation.<br />
E<strong>in</strong> weiteres Beobachtungsproblem zeigt sich durch die Schwierigkeit, nur etwas<br />
beschreiben zu können, was „äußerlich“ sichtbar ist (z.B. die Interaktionsmuster), <strong>in</strong> unserem<br />
Fall Familienmuster, Teammuster, Hierarchiemuster etc. Gedanken und Gefühle von<br />
Familien-, o<strong>der</strong> Teammitglie<strong>der</strong>n können nur erfragt werden. Erkenntnisse des<br />
Beobachtungsprozesses können daher nur aus den Interaktionsmustern und den subjektiven<br />
Beschreibungen <strong>der</strong> Familien- od. Teammitglie<strong>der</strong>n hergeleitet werden. Außerdem kann sich<br />
bereits die Beobachtungssituation durch die Anwesenheit des Beobachters „verän<strong>der</strong>n“, also<br />
Beobachtung das Beobachtete verän<strong>der</strong>n. In e<strong>in</strong>em solchen zirkulären Prozess zwischen<br />
Beobachter und Objekt wird e<strong>in</strong>e „neue Wirklichkeit geschaffen“ (siehe SIMON 1995a),<br />
ei <strong>der</strong> es sich dann um e<strong>in</strong>en neuen Gegenstand handelt, wobei auch <strong>der</strong> Beobachter<br />
verän<strong>der</strong>t wird.<br />
Der Beobachtungsprozess wird erleichtert, wenn sich <strong>der</strong> Beobachter <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e „exzentrische<br />
Position“ (PETZOLD 1993) begibt und so tut, als ob er außerhalb se<strong>in</strong>es Selbst stünde, um<br />
auf diese Weise auf sich und se<strong>in</strong>e Kommunikationspartner zu schauen. Wenn er und se<strong>in</strong><br />
Diskurspartner die Interaktionen und die Beziehungsgestaltung analysieren, können beide<br />
ihre subjektiven Innenperspektiven <strong>in</strong> gegenseitigen Identifikationen verstehen und sich<br />
durch die E<strong>in</strong>nahme <strong>der</strong> Außenperspektive auf e<strong>in</strong>e konsensuelle Realität e<strong>in</strong>igen (SIMON<br />
1995a).<br />
Diese Ausführungen über die Beobachtung haben grundlegende Bedeutung für die generelle<br />
Arbeit als Coach o<strong>der</strong> Berater. Im beson<strong>der</strong>en liegt die Bedeutung im Versuch Systeme <strong>in</strong><br />
Familien, Organisationen und E<strong>in</strong>zelpersonen zu erfassen. Welche Systeme bezeichnen wir<br />
nach unserer Analyse als „gesund“ o<strong>der</strong> „normal“ und welche als „krank“ o<strong>der</strong> „abnormal“?<br />
Diese Def<strong>in</strong>ition wird von den Beobachtern gezogen. Macht e<strong>in</strong> Beobachter (z.B. <strong>der</strong> Coach<br />
o<strong>der</strong> e<strong>in</strong> Kunde) Aussagen über e<strong>in</strong>en Menschen, e<strong>in</strong>e Familie o<strong>der</strong> e<strong>in</strong> an<strong>der</strong>es System,<br />
macht er gleichzeitig Aussagen über se<strong>in</strong> eigenes Verhalten. Der Untersuchende und das<br />
beobachtete System s<strong>in</strong>d beides Bestandteile e<strong>in</strong>es spezifischen Interaktionssystems, <strong>in</strong><br />
dem das Verhalten des e<strong>in</strong>en immer <strong>in</strong> „Ko-respondenz“ (PETZOLD 1993) mit dem<br />
Verhalten des an<strong>der</strong>en gesehen werden muss. Der Beobachter o<strong>der</strong> Forscher ist deshalb nie<br />
außenstehen<strong>der</strong> Beobachter, son<strong>der</strong>n er produziert das mit, was er beobachtet.<br />
Um Familien und Organisationen systemtheoretisch zu beschreiben, ist es nicht nur<br />
notwendig, die Position des Beobachters zu diskutieren, son<strong>der</strong>n auch darzustellen, was<br />
<strong>Theorie</strong> OÖ_ 1/281008 www.kutschera.org S36/113