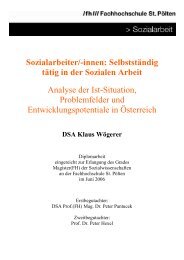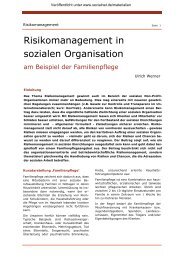Bachelorarbeit als PDF-Datei (2,9 MB) - Socialnet
Bachelorarbeit als PDF-Datei (2,9 MB) - Socialnet
Bachelorarbeit als PDF-Datei (2,9 MB) - Socialnet
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
!<br />
Bedingungen ökonomischer Rationalität gekettet. Das Gewinnprinizip wird nicht<br />
hinterfragt. Eine Lösung soll innerhalb seiner Logik gefunden werden.<br />
Ahlrichs bemerkt, dass die Governance-Ethik besonders für Unternehmen interessant<br />
erscheint, die international agieren 56 . Rein national tätige Unternehmen seien zwar<br />
auch von der Globalisierung betroffen, für sie könne eine staatliche Rahmenordnung<br />
moralisches Verhalten trotzdem vereinfachen. Nach Meinung der Autorin schließt die<br />
Arbeit an der Rahmenordnung den Wielandschen Ansatz auf Unternehmensebene<br />
aber nicht aus.<br />
Karmasin und Litschka beschreiben Wielands Vernachlässigung der Aspekte<br />
Gerechtigkeit und Freiheit. 57 . Beschorner kritisiert, dass Aspekte wie Innovation,<br />
Wandel, Lernen, Kultur und Wissen in der Governance Ethik keine Beachtung finden 58 .<br />
Wieland denkt systemtechnisch, wodurch sein Managementvorschlag bürokratisch<br />
erscheint. Bei aller Kritik weist Wielands Ansatz in einer in sich schlüssigen Theorie,<br />
eine praktische Perspektive auf, die in anderen Theorien eher unklar bleibt.<br />
Trotz ökonomischen Primats und Gewinnmaxime, hat Wielands Theorie einen<br />
integrativen Ansatz. Er funktionalisiert die Ethik nicht, wie bei Homann der Fall,<br />
sondern er definiert sie <strong>als</strong> einen Sprachmodus zur Verständigung über Gut und Böse.<br />
In seiner Theorie sind Unternehmen auf die Kenntnis und Anwendung dieses Modus<br />
angewiesen, um mit der Gesellschaft über deren Vorstellungen wünschenswerter<br />
wirtschaftlicher Handlung zu kommunizieren und kooperieren zu können. Unternehmen<br />
realisieren damit moralische Vorstellungen von Individuen. Die Bereitschaft und die<br />
Fähigkeit dies zu tun definiert Wieland <strong>als</strong> Tugend. Seine Ethik beschreibt er deshalb<br />
<strong>als</strong> starke Form der Tugendethik. 59<br />
6.3. Diskursethik (Habermas/Apel, Steinmann/Löhr)<br />
Die Philosophen Jürgen Habermas und Karl Otto Apel sind die Begründer der<br />
Diskursethik. In ihr geht es um die Begründung von Normen und Werten durch die<br />
Herstellung eines Konsens im machtfreien, rationalen und öffentlichen Diskurs 60 .<br />
Voraussetzung ist die Annahme, dass der Mensch über eine „immanente Sittlichkeit“<br />
verfügt. Nur mit ihr zusammen, lässt sich der Begründungsanspruch für ethische<br />
Normen aus einem solchen Diskurs ableiten. 61 Zwar begründen schon die<br />
Philosophen der Antike ethische Grundhaltungen durch Kommunikation, die Idee einer<br />
Systematisierung des Diskurses zur Begründung von Normen entsteht aber erst in den<br />
56 Ahlrichs, 2012, S. 42<br />
57 vgl. Karmasin & Litschka, 2008, S. 89<br />
58 vgl. Beschorner in Aßländer (Hrsg.), 2011, S. 130<br />
59 vgl. Wieland in Wieland, 2006, S. 7<br />
60 Karmasin & Litschka, 2008, S. 93<br />
61 vgl. Büscher in Aßländer, 2011, S. 103<br />
13!