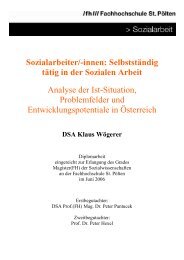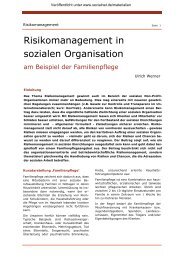Bachelorarbeit als PDF-Datei (2,9 MB) - Socialnet
Bachelorarbeit als PDF-Datei (2,9 MB) - Socialnet
Bachelorarbeit als PDF-Datei (2,9 MB) - Socialnet
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
!<br />
Prozess von Entscheidungsfindungen anbietet, die Werte, die hinter dessen<br />
Anwendung, und damit hinter einer konkreten Entscheidung stehen, aber keine Rolle<br />
spielen 67 . Dem könnte man entgegnen, dass die Annahme, dass der Diskurs unter<br />
oben beschriebenen Voraussetzungen <strong>als</strong> Garant für ethisch legitime Entscheidungen<br />
gilt, schon ganz bestimmte Werte impliziert, und zwar jene Werte, die hinter dem<br />
Diskurs selbst stehen: Freiheit, Gleichheit. Gerechtigkeit. Es ist dies eine Praxis der<br />
Kant‘schen Theorie. Der kategorische Imperativ <strong>als</strong> Grundlage ethischen Verhaltens<br />
verlangt, eine Norm daraufhin zu überprüfen, ob sie ohne Widerspruch verallgemeinert<br />
werden kann 68 . Diesen Prozess ermöglicht die Diskursethik. Sie ist somit<br />
deontologisch bestimmt. Der Ort der Moral liegt in der Rahmenordnung, die ethische<br />
Entscheidungen ermöglicht und verantwortet.<br />
6.4. Integrative Wirtschaftsethik (Peter Ulrich, ergänzt durch Amartya Sen)<br />
Peter Ulrich, Ökonom und Begründer der Integrativen Wirtschaftsethik, baut seine<br />
Theorie auf der Kritik des reinen Ökonomismus auf. 69 Innerhalb der Logik der<br />
Ökonomie komme es zu Sachzwängen. Beuge man sich ihnen im wirtschaftlichen<br />
Handeln, ginge die „Lebensdienlichkeit“ des Wirtschaftens verloren. Soziale und<br />
ökologische Zustände unserer Gegenwart zeigten, so Ulrich, dass aus rein<br />
ökonomisch vernünftigem, <strong>als</strong>o von Gewinnstreben geleitetem Handeln des Einzelnen,<br />
kein gutes Leben für Alle hervorgehe. Ulrich hat den Begriff der Lebensdienlichkeit <strong>als</strong><br />
normative Forderung an die Wirtschaft geprägt. Die wirtschaftliche Theorie habe sich,<br />
so Ulrich, in ihrer Logik von einem „lebensweltlichen“ Bezug abgelöst. Dorthinein,<br />
versucht er sie zu reintegrieren. Dafür müsse, so Ulrich, ökonomisches Denken und<br />
Handeln aber auf dem „Werteboden“ nicht mehr der ökonomischen, sondern in erster<br />
Linie der sozialen Vernunft, stattfinden. Die „Lebenswelt“ umfasst bei Ulrich, neben der<br />
Sicherung materieller Lebensgrundlagen, auch qualitative Merkmale wie „Sinn“ <strong>als</strong><br />
conditio humana, und „Lebensfülle“, die inhaltlich von soziokulturellen Umständen<br />
abhänge. Materielle Grundsicherung ist die Voraussetzung für das Leben <strong>als</strong> solches.<br />
Wie dieses Leben dann aussehen soll, müssten die Mitglieder einer Gesellschaft<br />
entscheiden. „Letzten Endes geht es nicht um die Systemorganisation, sondern um<br />
unsere Lebensform und den ihr angemessenen Wirtschaftsstil: Wie möchten wir in<br />
Zukunft leben? Dass ist die sozialökonomische Kernfrage der Zeit.“ 70 Gerechtigkeit und<br />
Gleichheit spielen eine große Rolle, um den Entscheidungsprozess zu ermöglichen.<br />
Die normative Grundlage der Wirtschaft soll kommunikativ entwickelt werden. Hierfür<br />
greift Ulrich auf die Diskursethik zurück (s. dort). Die Orte der Moral verteilt Ulrich auf<br />
67 vgl. Ahlrichs, 2012, S. 44<br />
68 vgl. Anhang 3: Grundlagen der Ethik, Deontologie, Anhang, S. A3<br />
69 zum Folgenden vgl. Ulrich, 2001, Kapitel 2,3,4<br />
70 Ulrich in Büscher in Aßländer, 2011, S. 106<br />
15!