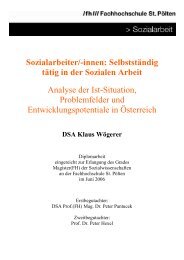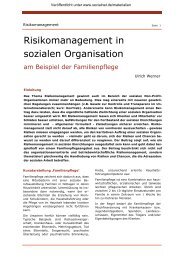Bachelorarbeit als PDF-Datei (2,9 MB) - Socialnet
Bachelorarbeit als PDF-Datei (2,9 MB) - Socialnet
Bachelorarbeit als PDF-Datei (2,9 MB) - Socialnet
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
A6<br />
rationalen Egoismus. „Er [der rationale Egoist] ist klug genug zu erkennen, dass er die<br />
Interessen anderer einkalkulieren muss“ 21 . Moralisches Handeln in Foge persönlicher<br />
Nutzenerwägung entsteht <strong>als</strong>o nur unter der Voraussetzungen von Rationalität.<br />
Setzen wir das Wohl den Interessen der Allgemeinheit gleich, dann finden sich<br />
sozialutilitaristische Gedanken bei den Kommunitaristen wieder. Diese abstrahieren,<br />
bei der Gestaltung von Normen vom Handeln und Wollen des Individuums zu Gunsten<br />
des Wollens der Gemeinschaft. Individuelle Entfaltung muss in Abstimmung mit den<br />
Interessen der Allgemeinheit erfolgen, das heißt mit der sozialen Gruppe, in die der<br />
Einzelne hineingeboren, und von der er abhängig ist. 22 Einzelne dürfen in ihren<br />
Interessen dabei geschädigt werden.<br />
Diskussion von Deontologie und Teleologie<br />
Vergleicht man beide Modelle, hat das teleologische zunächst den Reiz des<br />
Machbaren. Die Erfahrung zeigt, dass der Mensch egoistisch ist, und seinen Vorteil<br />
sucht. Einige Menschen behaupten sogar, noch jeder altruistische Funke sei egoistisch<br />
bedingt. Um dem moralisch zu begegnen, fordert Kant einen mächtigen Verstand vom<br />
Menschen. Dieser Verstand gibt ihm die Freiheit, sein Handeln zu gestalten. Freiheit<br />
wollen alle. Aber ist der Mensch in der Lage sie zu erfahren, in dem er seinen Verstand<br />
so benutzt wie Kant es fordert? Entspricht das dem Menschsein? Schon der<br />
hedonistische Epikur (ca. 341-270 v. Chr.) hat erkannt, dass kein Mensch in der Lage<br />
ist, die Folgen seines Handelns vollständig abzusehen. Was spricht <strong>als</strong>o dagegen, den<br />
Fokus auf die Handlungsfolgen zu legen? Was ist unmoralisch an einem moralischen<br />
Ergebnis; an Nutzen, Lust, Glück und Wohlergehen? Offensichtlich gar nichts. Doch<br />
wer definiert den Nutzen? „Was dem einen sein‘ Freud, ist dem anderen sein Leid“,<br />
weiß der Volksmund. Was ist das Gute, dass durch eine Tat entstehen soll? Und wie<br />
viel Gutes ist ein Nutzen? Wenn Interessen kollidieren: Wessen Nutzen hat Vorrang?<br />
Und endlich: was entspricht dem Menschsein? Gibt es wirklich nur den egoistisch<br />
motivierten Antrieb? Haben Menschen nicht auch andere Beweggründe?<br />
Weder Teleologie noch Deontologie können den Anspruch auf Alleingültigkeit erheben.<br />
Je nach persönlicher Disposition und Situation, wird die eine oder die andere Theorie<br />
überzeugender wirken. Für die Praxis scheint es wichtig, sich mit beiden Ansätzen<br />
beschäftigt zu haben, um einen Standpunkt entwickeln und vertreten zu können.<br />
Tugendethik<br />
Die Tugendethik ist ein eigenständiger ethischer Ansatz. Gleichzeitig schafft sie eine<br />
Verbindung zwischen Deontologie und Teleologie. Auch Sie hat ihren Ursprung im alten<br />
21 Herold, 2012. S. 67<br />
22 Karmasin & Litschka, 2008, S.90 f.