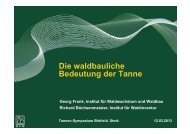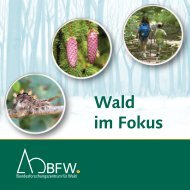Die forstlichen Wuchsgebiete Österreichs Eine - BFW
Die forstlichen Wuchsgebiete Österreichs Eine - BFW
Die forstlichen Wuchsgebiete Österreichs Eine - BFW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Die</strong> <strong>forstlichen</strong> <strong>Wuchsgebiete</strong> <strong>Österreichs</strong> 21<br />
Umgrenzung:<br />
Staatsgrenze - Lünersee - Kammlinie Zimba - Itons-<br />
Kopf - Rote Wand - Allgäuer Alpen/ Staatsgrenze bis<br />
Kastenkopf - Forchach - Knittelkar-Spitze - Thaneller<br />
- Bichlbach - Blattberg - Zugspitze - Wettersteinkamm<br />
- Unterkirchen - Arnspitze - Karwendelsüdkamm<br />
(Hafelekar-Spitze) - Achensee Südufer - Rofan<br />
- Wörgl - Bundesstr. 1 - St. Johann - Hochfilzen -<br />
Landesgrenze - Kitzbüheler Kamm - Grenze gegen<br />
die <strong>Wuchsgebiete</strong> 1.2 und 1.1 (siehe dort).<br />
Klima:<br />
Das Wuchsgebiet weist ein Übergangsklima vom subkontinentalen<br />
trockenen Innenalpenbereich zu den<br />
kühl-humiden Randalpen auf.<br />
<strong>Die</strong> Jahresniederschläge reichen von etwa 1000 mm<br />
in abgeschirmten Tallagen (Schwaz 535 m, 1010 mm)<br />
bis etwa 1900 mm in den von Westen überregneten<br />
Kammlagen (Langen am Arlberg: 1218 m, 1839 mm,<br />
Warth: 1500 m, 1841 mm). <strong>Die</strong> Niederschläge nehmen<br />
von Norden nach Süden rasch ab. Das sommerliche<br />
Niederschlagsmaximum ist deutlich ausgeprägt.<br />
<strong>Die</strong> schneereichen Winter sind weniger kalt und kontinental<br />
als in den Zentralalpen; die Sommertemperaturen<br />
liegen tiefer als in vergleichbaren Höhen der<br />
Zentralalpen. Trockenstandorte sind seltener.<br />
Ausgeprägte Föhnlagen sind für dieses Gebiet kennzeichnend.<br />
Geomorphologie:<br />
<strong>Die</strong> Gipfellagen liegen zwischen 3000 und 2000 m<br />
und sinken von Westen nach Osten ab. Nur im Westen<br />
ist das Gebiet geringfügig vergletschert. <strong>Die</strong><br />
Haupttäler verlaufen von West nach Ost.<br />
Dem dominierenden Klimacharakter der Nördlichen<br />
Zwischenalpen wurden die recht vielfältigen geochemisch-edaphischen<br />
Gegebenheiten untergeordnet: Das<br />
Wuchsgebiet umfaßt die Leelagen der Nördlichen<br />
Kalkalpen vor allem im Westen in einer breiten Zone,<br />
randliche Bereiche der zentralalpinen Gneise, die Innsbrucker<br />
Quarzphyllitberge sowie Teile der Kitzbühler<br />
Schieferalpen und die Sedimente des Inntales.<br />
Böden:<br />
Etwa die Hälfte aller Böden liegt auf Silikatgestein.<br />
Auch in diesem Wuchsgebiet herrscht auf Silikat Semipodsol<br />
vor (23% des <strong>Wuchsgebiete</strong>s bzw. über 40%<br />
der Silikatböden).<br />
Relativ weit (14% bzw. 26% der Silikatböden) und in<br />
tieferen Lagen als in den Innenalpen verbreitet ist Podsol<br />
- sowohl klimatisch begünstigt als auch wegen des<br />
hohen Anteils an basenarmem Gestein (Quarzphyllit).<br />
Klimadiagramme nach WALTER & LIETH (1960)<br />
für das Wuchsgebiet 2.1<br />
submontan<br />
submontan<br />
mittelmontan<br />
Auch magere Braunerde ist im Silikatgebiet vergleichsweise<br />
stärker vertreten (insgesamt 5%), während<br />
basenreiche Braunerde zurücktritt (7%).<br />
Auf silikatischem Substrat ferner Ranker sowie<br />
Braunerde auf Moräne, Terrassenschottern etc.<br />
Ein relativ großer Teil des <strong>Wuchsgebiete</strong>s fällt auf<br />
Kalkböden (43%) mit Rendsina (13%), Braunlehm-<br />
Rendsina (18%) und Kalkbraunlehm (12%) sowie etwas<br />
Kalkbraunerde.





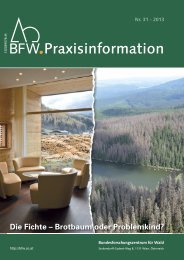








![pdf [7 MB] - BFW](https://img.yumpu.com/22350074/1/184x260/pdf-7-mb-bfw.jpg?quality=85)