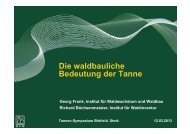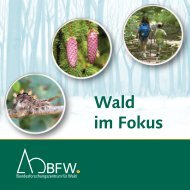Die forstlichen Wuchsgebiete Österreichs Eine - BFW
Die forstlichen Wuchsgebiete Österreichs Eine - BFW
Die forstlichen Wuchsgebiete Österreichs Eine - BFW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Die</strong> <strong>forstlichen</strong> <strong>Wuchsgebiete</strong> <strong>Österreichs</strong> 29<br />
de-Podsol-Reihe. Konkrete Daten der Forstinventur<br />
können für dieses Wuchsgebiet nicht abgeleitet werden.<br />
Abgesehen von den etwas stärker vertretenen Karbonatgesteinsböden<br />
ist aber die Verteilung der Bodenformen<br />
jener des Wuchsgebiets 3.2 ähnlich. Infolge der<br />
größeren Massenhebung dürfte die Verbreitung von<br />
Braunerde auf saurem Substrat etwas geringer sein.<br />
Das steilere Relief bedingt das häufige Vorkommen<br />
von Ranker unter Wald.<br />
Höhenstufen: m<br />
Submontan 500 - 800 (950)<br />
Tiefmontan 800 - 1100 (1300)<br />
Mittelmontan 1100 - 1400 (1450)<br />
Hochmontan 1400 - 1650 (1800)<br />
Tiefsubalpin (1500) 1650 - 1900 (2100)<br />
Hochsubalpin (1750) 1900 - 2100 (2200)<br />
Natürliche Waldgesellschaften:<br />
Durch das vorgeschobene Vorkommen von Blumenesche,<br />
Hopfenbuche und Dreiblatt-Windröschen<br />
(Anemone trifolia) in den Tallagen (z.B. Drautal) wird<br />
in diesem Wuchsgebiet bereits ein stärkerer submediterran-illyrischer<br />
Einfluß spürbar. <strong>Die</strong> Höhenstufengrenzen<br />
sind gegenüber dem Wuchsgebiet 3.2 deutlich<br />
(ca. 100-150 m) nach oben verschoben.<br />
. Submontane Eichen-Rotföhrenwald-Fragmente<br />
und submontan-tiefmontane Vorposten von Hopfenbuchen-Blumeneschenwald.<br />
. Fichten-Tannenwald (Leitgesellschaft) in der submontanen<br />
und montanen Stufe, häufig anthropogen<br />
an Tanne verarmt. In den submontanen bis<br />
mittelmontanen Ausbildungen mit stärkerer Beimischung<br />
von Buche.<br />
Auf ärmeren Silikatstandorten Hainsimsen-Fichten-Tannenwald<br />
(Luzulo nemorosae-Piceetum), auf tiefergründigen, basenreichen<br />
Böden Sauerklee-Fichten-Tannenwald (Galio ro-<br />
Gemeinsames Merkmal des Hauptwuchsgebietes ist<br />
das kühl-humid-mitteleuropäische Klima mit häufigen,<br />
langandauernden Stauregen, deren Intensität jedoch<br />
geringer ist als in den Südalpen. Hier liegt das<br />
nordalpische Buchenoptimum.<br />
Das große Hauptwuchsgebiet umfaßt einen beachtlichen<br />
klimatischen West-Ost-Gradienten, der eine Unterteilung<br />
nahelegt, ebenso wie zwei sehr unterschiedliche<br />
geomorphologische Zonen, die Flysch- und die<br />
Hauptwuchsgebiet 4: Nördliche Randalpen<br />
tundifolii-Piceetum). Auf Karbonat z.B. Alpendost-Fichten-<br />
Tannenwald (Adenostylo glabrae-Abietetum).<br />
. Tannenfreier montaner Fichtenwald auf lokalklimatisch<br />
(Frostbeckenlagen) oder edaphisch (anmoorige<br />
Standorte, Blockhalden) bedingten Sonderstandorten.<br />
. Auf Karbonatstandorten (“laubbaumfördernde Unterlage”)<br />
und in der submontanen bis tief(-mittel)montanen<br />
Stufe auch Fichten-Tannen-Buchenwald.<br />
Z.B. Dreiblatt-Windröschen-Fichten-Tannen-Buchenwald<br />
(Anemono trifoliae-(Abieti-)Fagetum) auf Karbonat, Hainsimsen-Fichten-Tannen-Buchenwald<br />
(Luzulo nemorosae-<br />
(Abieti-)Fagetum) auf Silikat.<br />
. Rotföhrenwälder als submontane bis mittel(-hoch)montane<br />
Dauergesellschaften an flachgründigen,<br />
trockenen Standorten.<br />
Schneeheide-Rotföhrenwald (Erico-Pinetum sylvestris) über<br />
Karbonat und Silikat-Rotföhrenwald (Vaccinio vitis-idaeae-<br />
Pinetum).<br />
. Grauerlenbestände (Alnetum incanae) als Auwald<br />
und an feuchten Hängen (z.B. Muren, Lawinenzüge)<br />
von der submontanen bis in die hochmontane Stufe.<br />
. Tiefsubalpiner Fichtenwald.<br />
V.a. Alpenlattich-Fichtenwald (Larici-Piceetum) über Silikat,<br />
auch Karbonat-Alpendost-Fichtenwald (Adenostylo glabrae-<br />
Piceetum).<br />
. Hochsubalpiner Silikat-Lärchen-Zirbenwald (Larici-Pinetum<br />
cembrae).<br />
. Karbonat-Latschengebüsche mit Wimper-Alpenrose<br />
(Rhododendron hirsutum) in der hochsubalpinen<br />
Stufe, an ungünstigen Standorten (z.B. Schuttriesen,<br />
Lawinenzüge) weit in die montane Stufe hinabreichend.<br />
Silikat-Latschengebüsche mit Rostroter Alpenrose<br />
(Rhododendron ferrugineum).<br />
. Subalpines Grünerlengebüsch (Alnetum viridis) an<br />
feuchten, schneereichen Standorten (Lawinenstriche).<br />
Kalkalpen. <strong>Die</strong> Gliederung “Kartierung” hat dem<br />
durch Ausscheidung von 4 gleichrangigen Wuchsräumen<br />
Rechnung getragen. <strong>Die</strong> vorliegende hierarchisch<br />
gestaffelte Wuchsgebietsgliederung läßt dies nicht zu.<br />
Es stand zur Wahl, zur Wuchsgebietsgliederung die<br />
geomorphologisch-pedologische Komponente oder<br />
das Klima in den Vordergrund zu stellen, also im ersten<br />
Fall Flyschzone und Kalkalpen zu trennen. <strong>Die</strong> Bodenunterschiede<br />
sind markant und für die Baumarten-


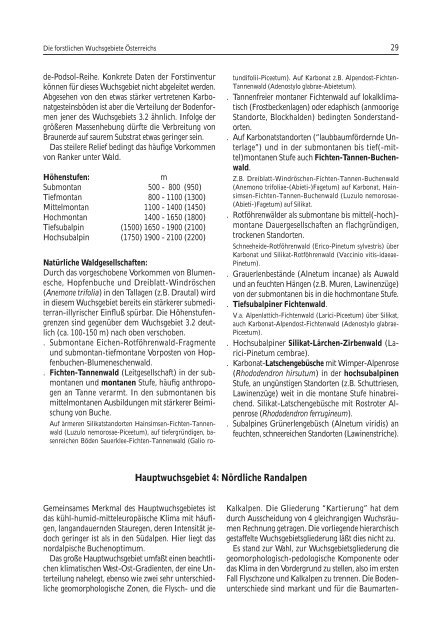


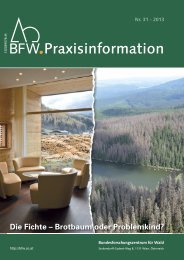








![pdf [7 MB] - BFW](https://img.yumpu.com/22350074/1/184x260/pdf-7-mb-bfw.jpg?quality=85)