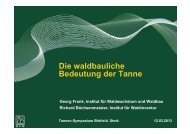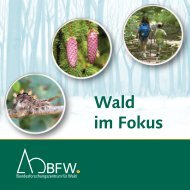Die forstlichen Wuchsgebiete Österreichs Eine - BFW
Die forstlichen Wuchsgebiete Österreichs Eine - BFW
Die forstlichen Wuchsgebiete Österreichs Eine - BFW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Die</strong> <strong>forstlichen</strong> <strong>Wuchsgebiete</strong> <strong>Österreichs</strong><br />
<strong>Die</strong> älteste Tradition außerhalb <strong>Österreichs</strong> zur Verwendung<br />
standortskundlich motivierter forstlicher<br />
Landschaftsgliederungen und die umfangreichste Datengrundlage<br />
besitzt allerdings Deutschland (SCHLEN-<br />
KER 1975, 1987, WITTMANN 1983).<br />
Problemstellung<br />
Der Zustand, daß drei verschiedene forstliche Wuchsgebietsgliederungen<br />
nebeneinander - wenn auch für<br />
unterschiedliche Zwecke - innerhalb der österreichischen<br />
Forstwirtschaft, ja selbst innerhalb der FBVA in<br />
Gebrauch sind, wird als untragbar empfunden.<br />
Vor allem anlässlich der heranstehenden rechtlichen<br />
Neuregelung über den Verkehr mit forstlichem Vermehrungsgut,<br />
sowie bei der Auswertung einer Vielzahl<br />
derzeit laufender großer Erhebungssysteme im<br />
Bereich der Forstwirtschaft (Waldinventur, Waldschaden-Beobachtungssystem,<br />
Bodenzustandsinventur)<br />
aber auch universitärer Projekte (z.B. MAB-Projekt<br />
über den Hemerobiegrad der österr. Wälder) ist das<br />
Fehlen einer einheitlichen, ökologisch fundierten und<br />
universell anwendbaren Landschaftsgliederung empfindlich<br />
fühlbar und akut geworden.<br />
Es galt daher, ein altes, immer wieder zurückgestelltes<br />
Projekt der Forstlichen Bundesversuchsanstalt zu<br />
reaktivieren und unverzüglich eine solche Gliederung<br />
zu schaffen.<br />
Allen drei bisherigen <strong>forstlichen</strong> Gliederungen<br />
<strong>Österreichs</strong> liegt eine außerordentlich große Fülle von<br />
Beobachtungsmaterial zugrunde, das seither nicht so<br />
wesentlich erweitert und zumindest nicht widerlegt<br />
worden ist, daß es eine völlig neue, die bisherigen<br />
Grundlagen umstoßende, “endgültige” Wuchsraumgliederung<br />
begründen würde.<br />
Auch ein neuer Gliederungsversuch muß zudem<br />
ein Provisorium bleiben, solange nicht durch eine<br />
flächendeckende Standortskartierung der immer<br />
noch lückenhafte Kenntnisstand wesentlich vertieft<br />
worden ist. Liegen doch bei weitem nicht die pollenanalytischen<br />
Unterlagen und Kartierungsergebnisse<br />
vor wie etwa in Deutschland. Und selbst dort wurde<br />
erst nach weitgehendem Abschluß jahrzehntelanger<br />
Standortskartierungen an “eine Überarbeitung der<br />
Wuchsgebietsgliederung, auch methodisch, zur Erweiterung<br />
auf außerforstliche Zielsetzungen” gedacht<br />
(SCHLENKER 1987).<br />
Der einzig gangbare Weg für Österreich kann zum<br />
derzeitigen Zeitpunkt also nur die Zusammenführung<br />
der bestehenden Gliederungen sein. Da es<br />
schon das Ziel der beiden jüngeren Konzepte war, die<br />
alte, als überholt betrachtete Gliederung TSCHERMAKS<br />
zu ersetzen, kann diese dabei unberücksichtigt bleiben.<br />
Ein Problem bleibt allenfalls die in der Praxis<br />
eingebürgerte alphanumerische Kennzeichnung der<br />
Wuchs- und Herkunftsgebiete.<br />
In vielen Belangen sind seit den älteren Konzepten<br />
aber doch zahlreiche neue Kenntnisse hinzugekommen,<br />
welche in der vorliegenden Darstellung berücksichtigt<br />
wurden: Zunächst ist die Kenntnis der natürlichen<br />
Waldgesellschaften und ihrer systematischen<br />
Stellung heute so weit fortgechritten, daß für alle<br />
<strong>Wuchsgebiete</strong> die wichtigsten Waldgesellschaften für<br />
die jeweiligen Höhenstufen und Standorte aufgelistet<br />
werden können. Damit ist die Möglichkeit geschaffen,<br />
Vermehrungsgut innerhalb der gleichen natürlichen<br />
Waldgesellschaft zu übertragen. Auch bei Transfer<br />
von Herkünften aus einem benachbarten Wuchsgebiet<br />
erleichtert der Vergleich der natürlichen Waldgesellschaften<br />
des Herkunfts- und Verwendungsortes<br />
die Einschätzung der Eignung des Pflanzgutes.<br />
Weiters kann eine überarbeitete Darstellung der<br />
Höhenstufen gegeben werden. Für diese nach pflanzensoziologischen<br />
Kriterien erstellten klimatischen<br />
Höhenstufen haben unter anderem die zahlreichen<br />
Standortserkundungen der FBVA und zuletzt die Bodenzustandsinventur<br />
viele zusätzliche Informationen<br />
gebracht, vor allem über die Lage und Ausbildung der<br />
Höhenstufen in den einzelnen <strong>Wuchsgebiete</strong>n. <strong>Die</strong><br />
neue Verordnung über das forstliche Vermehrungsgut<br />
wird diese nach klimatisch-pflanzensoziologischen<br />
Kriterien erstellten Höhenstufen übernehmen.<br />
Damit ist wiederum der Transfer von Saat- und<br />
Pflanzgut auf ökologisch gleichwertige Lagen erleichtert,<br />
im Gegensatz zu den nach der derzeit geltenden<br />
Forstsaatgutverordnung unterschiedenen fixen Seehöhenangaben.<br />
Schließlich ist von der Waldbodenzustandsinventur,<br />
der Österreichischen Waldinventur und zahlreichen<br />
Einzelprojekten her umfangreiches Datenmaterial<br />
über die in den <strong>Wuchsgebiete</strong>n vorkommenden<br />
Böden verfügbar, worauf in der Beschreibung der<br />
<strong>Wuchsgebiete</strong> ebenfalls in der gebotenen Kürze<br />
zurückgegriffen werden kann.<br />
Ausblick<br />
Für eine definitive Darstellung der <strong>Wuchsgebiete</strong><br />
einschließlich der Aufdeckung kausaler Zusammenhänge,<br />
etwa die flächenhafte Verknüpfung von klimatischen<br />
Kennwerten und Waldgesellschaften (Indexzahlen<br />
etc.) fehlen immer noch ausreichende Unter-<br />
7





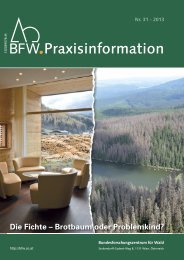








![pdf [7 MB] - BFW](https://img.yumpu.com/22350074/1/184x260/pdf-7-mb-bfw.jpg?quality=85)