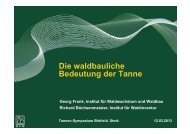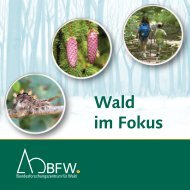Die forstlichen Wuchsgebiete Österreichs Eine - BFW
Die forstlichen Wuchsgebiete Österreichs Eine - BFW
Die forstlichen Wuchsgebiete Österreichs Eine - BFW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Die</strong> <strong>forstlichen</strong> <strong>Wuchsgebiete</strong> <strong>Österreichs</strong> 47<br />
<strong>Die</strong> Winter sind mit Ausnahme einiger wärmebegünstigter<br />
Lagen kälter als im östlichen Alpenvorland;<br />
somit ergeben sich gegenüber Wuchsgebiet 7.2 längere<br />
Schneedeckendauer und kürzere Vegetationszeit.<br />
Auch die Juli-Mitteltemperaturen sind im allgemeinen<br />
etwas geringer als im Ostteil des Alpenvorlandes.<br />
<strong>Die</strong> montanen Rücken und Hochflächen sind stark<br />
windausgesetzt.<br />
Geomorphologie:<br />
Vorwiegend flachwelliges Hügelland aus tertiären Sedimenten,<br />
im Südwesten Moränenlandschaft. Vor den<br />
Endmoränenwällen liegen Sander- und Schotterfluren.<br />
Entlang des Inn und der Traun befinden sich Schotterterrassen.<br />
Nur einzelne Flyschklippen und die tertiäre,<br />
zertalte Schotterplatte des Hausruck - Kobernaußerwaldes<br />
bilden markantere Höhenzüge.<br />
Der nördliche Teil trägt eine fast durchgehende Lößund<br />
Staublehmdecke. Im Innviertel treten unter der<br />
Lößdecke die tertiären, tonigen Sedimente (=Schlier)<br />
zutage. Im Süden tritt an ihre Stelle Moränenmaterial.<br />
Böden:<br />
Bindige Braunerde und Parabraunerde findet man auf<br />
Löß (8%) oder auf Staublehm und Moräne (9%); auf<br />
Grundmoräne ist sie sehr dichtgelagert, selbst seichtgründige<br />
Böden neigen dort zu Wasserstau.<br />
<strong>Eine</strong>n großen Anteil nimmt Pseudogley auf Schlier,<br />
Staublehm und v.a. älterem Löß, seltener auf Moräne,<br />
sowie Grundwassergley ein (zusammen 24%).<br />
Pararendsina (1%) und leichte Braunerden (24%)<br />
sind auf Moräne, Schotter und Sand entwickelt.<br />
<strong>Die</strong> tertiären Schotter des Hausruck tragen saure,<br />
steinige, meist podsolige Braunerde bis Podsol.<br />
Während die fruchtbaren Böden unter Acker- und<br />
Grünlandkultur stehen, sind die podsoligen Böden<br />
dem Wald verblieben. Ihr Anteil an der Waldfläche<br />
beträgt daher 25%!<br />
Ferner gibt es Auböden (5%), Anmoore, Niedermoore<br />
und Hochmoore (3% der Waldfläche).<br />
Höhenstufen: m<br />
Submontan ~300 - 600<br />
Tiefmontan 600 - 801<br />
Natürliche Waldgesellschaften:<br />
Von Natur aus sind hier nährstoffreiche, leistungsfähige<br />
Laubmischwald-Standorte verbreitet; die besseren<br />
Standorte sind allerdings unter landwirtschaftlicher<br />
Nutzung (Äcker, Grünland).<br />
Ersatzgesellschaften mit Fichte (Rotföhre) nehmen<br />
den größten Anteil an der Waldfläche ein. <strong>Die</strong> natür-<br />
liche Waldvegetation ist daher vielfach nur schwer erkennbar.<br />
Häufig sind Vergrasungen mit Seegras (Carex<br />
brizoides), z.T. gibt es auch Degradationen mit<br />
Torfmoos (Sphagnum), Pfeifengras (Molinia).<br />
. Submontaner Stieleichen-Hainbuchenwald (Galio<br />
sylvatici-Carpinetum) an wärmebegünstigten,<br />
trockenen Standorten oder auf schlecht durchlüfteten,<br />
bindigen, staunassen Böden; meist durch<br />
Fichtenbestände ersetzt.<br />
. In der submontanen Stufe Buchenwald mit Tanne<br />
(Edellaubbaumarten, Stieleiche, Rotföhre), tiefmontan<br />
(Fichten-)Tannen-Buchenwald.<br />
Hainsimsen-(Tannen-)Buchenwald (Luzulo nemorosae-<br />
(Abieti-)Fagetum auf ärmeren, bodensauren und Waldmeister-(Tannen-)Buchenwald<br />
(Asperulo odoratae-(Abieti-)Fagetum)<br />
auf basenreicheren Standorten. Auf den Kalkschotter-<br />
Terrassen (z.B. Traun, Salzach) auch Kalk-Buchenwälder (z.B.<br />
Carici albae-Fagetum).<br />
. Peitschenmoos-Fichten-Tannenwald (Mastigobryo-<br />
Piceetum) mit Torfmoos auf bodensauren, staunassen<br />
Standorten wohl meist anthropogen entstanden,<br />
ursprünglich mit höherem Buchen- und<br />
Stieleichenanteil; kleinflächig vielleicht auch als<br />
edaphisch bedingte Dauergesellschaft.<br />
. Auwälder der größeren Flußtäler:<br />
Silberweiden-Au (Salicetum albae) als Pioniergesellschaft<br />
auf schluffig-sandigen Anlandungen, Purpurweiden-Filzweiden-Gebüsch<br />
(Salicetum incanopurpureae)<br />
auf Schotter. Grauerlen-Au (Alnetum<br />
incanae) gut entwickelt.<br />
Bei weiter fortgeschrittener Bodenentwicklung und<br />
nur mehr seltener Überschwemmung Hartholz-Au<br />
mit Esche, Bergahorn, Grauerle, Stieleiche, Winterlinde:<br />
In Alpennähe (z.B. Salzach) mit Bergulme<br />
(Carici pendulae-Aceretum =Aceri-Fraxinetum),<br />
am Inn auch mit Feldulme (Querco-Ulmetum).<br />
Auf durchlässigen Schotterböden (Alm-Auen)<br />
außerdem (Fichten-)Rotföhrenbestände (Dorycnio-Pinetum<br />
s.lat.).<br />
. Entlang der kleineren Bäche Grauerlen-Au (Alnetum<br />
incanae) und Eschen-Schwarzerlen-Bachauwälder<br />
(Carici remotae-Fraxinetum, Pruno-Fraxinetum).<br />
. Schwarzerlen-Bruchwald (Carici elongatae-Alnetum<br />
glutinosae) auf Standorten mit hochanstehendem,<br />
stagnierendem Grundwasser.<br />
. Schneeheide-Rotföhrenwald (Erico-Pinetum sylvestris)<br />
kleinflächig als Dauergesellschaft an Konglomeratschutt-Steilhängen<br />
(Traunschlucht).<br />
. An nährstoffreichen, frischen, meist rutschgefährdeten<br />
Standorten (z.B. Grabeneinhänge) Laubmischwälder<br />
mit Bergahorn, Esche und Bergulme,<br />
z.B. Geißbart-Ahornwald (Arunco-Aceretum) und<br />
Bergahorn-Eschenwald (Carici pendulae-Aceretum).





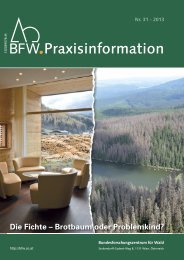








![pdf [7 MB] - BFW](https://img.yumpu.com/22350074/1/184x260/pdf-7-mb-bfw.jpg?quality=85)