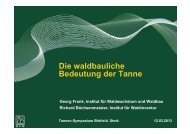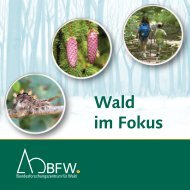Die forstlichen Wuchsgebiete Österreichs Eine - BFW
Die forstlichen Wuchsgebiete Österreichs Eine - BFW
Die forstlichen Wuchsgebiete Österreichs Eine - BFW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
58<br />
FBVA-Berichte 82<br />
der Forstlichen Bundesversuchsanstalt, als auch vom<br />
Institut für Standortskunde der FBVA aufgrund zahlreicher<br />
Erhebungen und Standortskartierungen erstellt<br />
wurden.<br />
<strong>Die</strong> Gliederung umfaßt 22 <strong>Wuchsgebiete</strong>, die in 9<br />
Hauptwuchsgebiete zusammengefaßt sind.<br />
In der Gewichtung der zur Abgrenzung verwendeten<br />
Faktoren haben Regionalklima und die durch den<br />
Klimacharakter geprägten Waldgesellschaften Vorrang<br />
gegenüber geomorphologisch und bodenkundlich<br />
definierten Naturraumeinheiten. Daher wurden die<br />
im alpinen Bereich befindlichen <strong>Wuchsgebiete</strong> entsprechend<br />
dem Kontinentalitätsgradienten je nach Innen-,<br />
Zwischen- und Randalpenlage gruppiert.<br />
Damit wird der großräumigen Differenzierung der<br />
Waldgesellschaften in kontinental getönte Fichtenwaldgebiete<br />
der Innenalpen, die im Norden, Süden<br />
und Osten von einem Band der zwischenalpinen<br />
Fichten-Tannenwaldgesellschaften umschlossen sind,<br />
die wiederum vom Laubwaldgebiet der Randalpen<br />
abgegrenzt sind, entsprochen.<br />
<strong>Die</strong> innerhalb der Hauptwuchsgebiete getroffene<br />
Abgrenzung der <strong>Wuchsgebiete</strong> im alpinen Raum folgt<br />
ebenfalls klimatischen Gegebenheiten (West-Ost Gradient,<br />
pannonischer bzw. illyrischer Klimaeinfluß).<br />
<strong>Die</strong> außeralpinen Hauptwuchsgebiete (Nördliches<br />
Alpenvorland, Sommerwarmer Osten, Mühl- und<br />
Waldviertel) entsprechen den großräumig geomorphologisch<br />
bzw. klimatisch vorgegebenen Landschaften<br />
und sind auf Grundlage regionaler Klimabedingungen<br />
in <strong>Wuchsgebiete</strong> unterteilt.<br />
<strong>Die</strong> regionale Eigenart der <strong>Wuchsgebiete</strong> wird in<br />
entscheidender Weise durch die seehöhenabhängigen<br />
Klima- und Vegetationsgradienten überlagert und in<br />
der Abgrenzung und Beschreibung von Höhenstufen<br />
berücksichtigt. Für waldbauliche und herkunftsbezogene<br />
Fragestellungen haben die durch die Höhenstufen<br />
charakterisierten vertikalen Merkmalsunterschiede<br />
sogar größere Bedeutung als die horizontalen Abstufungen.<br />
Insgesamt wurden sieben Höhenstufen unterschieden,<br />
die in drei Höhengürtel (Tief-, Mittel- und<br />
Hochlage) zusammengefaßt sind. <strong>Die</strong> Höhenstufen<br />
werden mit den in der pflanzensoziologischen Literatur<br />
gebräuchlichen Begriffen bezeichnet und sind<br />
ausschließlich nach klimatisch-pflanzensoziologischen<br />
Gesichtspunkten und nicht nach bestimmten<br />
Seehöhenwerten definiert.<br />
<strong>Die</strong> Beschreibung jedes <strong>Wuchsgebiete</strong>s enthält folgende<br />
Abschnitte:<br />
. Entsprechung: Gegenüberstellung mit bisherigen<br />
Gliederungen bzw. Entwürfen.<br />
. Lage: Kurze geographische Beschreibung.<br />
. Höhenerstreckung: Seehöhe des tiefsten und höchsten<br />
Punktes.<br />
. Umgrenzung: Beschreibung des Grenzverlaufs.<br />
. Klima: Kurzcharakteristik, ergänzt durch Klimadiagramme<br />
nach WALTER-LIETH.<br />
. Geomorphologie: Kurzbescheibung des Auftretens<br />
von Geländeformen und des bodenbildenden Ausgangsmaterials.<br />
. Böden: Auftreten und Schätzung der Flächenverteilung<br />
von Bodentypen<br />
. Höhenstufen: Höhenangaben als Rahmenwerte, innerhalb<br />
welcher die Höhenstufengrenzen je nach<br />
den lokalen Standortsbedingungen schwanken.<br />
. Natürliche Waldgesellschaften: Aufzählung der wichtigsten<br />
natürlichen Waldgesellschaften mit ihren<br />
standortskundlichen Merkmalen, geordnet nach ihrer<br />
Höhenverbreitung. Hervorgehoben ist jene<br />
Waldgesellschaft, die das Wuchsgebiet charakterisiert<br />
bzw. dessen Verbreitung zur Abgrenzung verwendet<br />
wurde (Leitgesellschaft, Regionalwaldgesellschaft).<br />
Vorliegende Gliederung bedarf bis zu einer endgültigen<br />
Darstellung einer weiteren Bearbeitung in folgenden<br />
Bereichen:<br />
. Kausale Zusammenhänge der Verbreitung von Waldgesellschaften<br />
mit Standortsbedingungen (z.B. Klimakennwerte).<br />
. Forstgenetisch-geographische Differenzierung innerhalb<br />
der Baumarten.<br />
. Pflanzensoziologische Arbeiten zur Abgrenzung der<br />
potentiell natürlichen Waldvegetation.<br />
. Flächendeckende Standortskartierung.<br />
Danksagung:<br />
Wir danken allen Kollegen, die zu dieser Arbeit beigetragen haben,<br />
insbesondere Dipl.-Ing. Dr. Günther Eckhart, Dipl.-Ing. Johann<br />
Nather und Dr. Roland Stern für wesentliche Beiträge zu<br />
den ersten Konzepten, Prof. Dr. Kurt Zukrigl, Mag. Karl Gartner<br />
und Prof. Dr. Harald Niklfeld für wertvolle Diskussionsbeiträge<br />
und die kritische Durchsicht des Manuskripts.





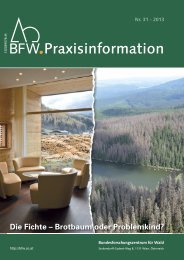








![pdf [7 MB] - BFW](https://img.yumpu.com/22350074/1/184x260/pdf-7-mb-bfw.jpg?quality=85)