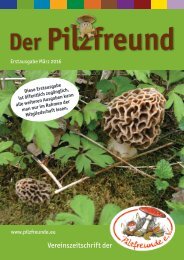Der Pilzfreund - Ausgabe 4
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Unter einem Hut<br />
Das wichtigste Merkmal ist die Stieloberfläche: Diese ist<br />
bei Macrolepiota genattert. Das bedeutet, dass die Oberfläche<br />
in kleine, flache Schüppchen aufbricht, die sich in<br />
einem bestimmten Muster anordnen und aussehen wie<br />
eine Schlangenhaut. Nur bei ganz jungen Pilzen, wo die<br />
Hüte noch komplett geschlossen sind, ist dieses Detail<br />
noch nicht ausgeprägt.<br />
Bei den Safranschirmlingen ist die Stieloberfläche niemals<br />
genattert. Die Stiele sind glatt oder längsfaserig.<br />
Bei jungen Safranschirmlingen läuft das Fleisch im Längsschnitt<br />
rasch deutlich safranrot an. Bei Riesenschirmlingen<br />
verfärbt es sich – wenn überhaupt – in der Stielrinde<br />
weinrot. Allerdings ist die Verfärbung bei alten und/oder<br />
trockenen Fruchtkörpern oft nicht mehr sichtbar, weswegen<br />
man immer auf den genatterten Stiel achten muss.<br />
Beiden Gattungen gemeinsam sind die großen bis sehr<br />
großen Fruchtkörper mit grob geschuppten Hüten. Dabei<br />
liegen grobe, ledrig–häutige Schuppen auf einem fein<br />
wollig geschuppten Untergrund auf. Die oberen, groben<br />
Schuppen sind teils vergänglich, nur in der Hutmitte, wo<br />
sie zusammenhängen, werden sie auch im Alter so gut wie<br />
nie vergehen. Das Sporenpulver aller Riesenschirmlinge<br />
(Macrolepiota und Chlorophyllum) ist weißlich oder blass<br />
weißlichrosa bis blass grünweißlich. Die Lamellen sind<br />
frisch cremeweiß, später werden erst die Lamellenschneiden<br />
bräunlich, dann flecken die ganzen Lamellen. Sind<br />
die Lamellen bereits bräunlich angelaufen, sollte man die<br />
Fruchtkörper nicht mehr essen. Die Lamellen erreichen<br />
den Stiel nicht, sie enden in einem Wulst, der wie ein Ring<br />
an der Hutunterseite um die Stielspitze herum liegt.<br />
Riesenschirmlinge haben dicke, beständige Ringe (zumeist<br />
doppelt, ähnlich wie Oreo-Keks oder Prinzen-Rolle).<br />
Diese Ringe sind nicht fest mit der Stieloberfläche verwachsen<br />
und lassen sich verschieben. Allerdings kleben<br />
sie gerne daran fest bzw. sitzen so eng um den Stiel, dass<br />
man nicht von „verschiebbar“ sprechen kann. Wie immer<br />
können Ringe gelegentlich abfallen, also sollte man auch<br />
alle anderen Merkmale berücksichtigen. Die Ringstruktur<br />
ist recht einzigartig und unterscheidet die Riesenschirmlinge<br />
nicht nur von giftigen Wulstlingen (Gattung: Amanita),<br />
sondern auch von kleineren Schirmlingen (Gattung:<br />
Lepiota), von denen es eben auch „größere kleine“<br />
Schirmlinge gibt. Ein klassischer Verwechslungspartner<br />
des Parasols ist der Spitzschuppige Stachelschirmling (Lepiota<br />
aspera bzw. Echinoderma aspera). Aber dieser hat einen<br />
häutigen, mit dem Stiel verwachsenen Ring, der ganz<br />
und gar keine Oreokeks-Struktur hat. Am prägnantesten<br />
sind in der Tat die Parasole (Macrolepiota procera), sie sind<br />
die bekanntesten Riesenschirmlinge. Arten wie der Sternschuppige<br />
Riesenschirmling (Macrolepiota rhodosperma,<br />
früher auch Macrolepiota konradii) oder der Zitzen-Riesenschirmling<br />
(Macrolepiota mastoidea) sind geschmacklich<br />
gleichwertig und auch für sie gelten die oben genannten<br />
Macrolepiota-Merkmale, um sie von Wulstlingen, anderen<br />
Schirmlingen und auch von den Safranschirmlingen mit<br />
dem giftigen Gerandetknolligen Garten-Safranschirmling<br />
(Chlorophyllum brunneum) abgrenzen zu können.<br />
Schwarze Sporen<br />
Ein Pilz, der zwar häufig und auffällig ist, aber dafür recht<br />
wenig gesammelt wird, ist der Schopftintling (Coprinus<br />
comatus). Vielleicht liegt es daran, dass die Fruchtkörper<br />
so kurzlebig sind und schon bald zu einem schwarzen<br />
Brei zerfließen. Außerdem besiedeln sie gerne Stellen,<br />
die nicht zu den typischen Jagdgebieten der Sammler<br />
gehören. Das sind Gärten, Wiesenflächen im städtischen<br />
Bereich und Weg- sowie Straßenränder. Man muss natürlich<br />
darauf achten, diese Pilze nicht unbedingt auf einem<br />
„Hundeklo“ oder neben einer viel befahrenen Verkehrsader<br />
zu sammeln. Auch ist es wichtig, nur junge Exemplare<br />
mitzunehmen, deren Hüte noch geschlossen und „walzenförmig“<br />
sind, also solche mit noch völlig weißen Lamellen.<br />
Nach dem Sammeln entwickeln sich die Fruchtkörper<br />
aber rasch weiter, wollen die Sporen zur Reife bringen und<br />
verfallen dabei recht schnell. Darum muss man diese Pilze<br />
schnell verwerten, auf jeden Fall noch am Sammeltag, am<br />
besten innerhalb weniger Stunden. Möglicherweise hält<br />
auch das manchen <strong>Pilzfreund</strong> vom Sammeln ab. Wichtige<br />
Merkmale sind die lang aufschießenden, hohlen Stiele,<br />
die oft beringt und immer (auch im Alter noch) rein weiß<br />
sind. Wenn sich der Hut aufgelöst hat, bleibt der Stiel<br />
noch eine ganze Weile stehen, was ihm den Namen „Spargelpilz“<br />
eingebracht hat. Das Sporenpulver ist schwarz,<br />
beim Auflösen des Hutes tropft es wie Tinte zu Boden. Bei<br />
jungen Pilzen sind die Lamellen weiß, anschließend färben<br />
sie sich vom Hutrand aus rosa je weiter der Hut sich<br />
öffnet, desto dunkler werden sie, lösen sich dabei auf wie<br />
der ganze Hut. Jung sind die Hüte walzenförmig-länglich,<br />
Parasol Foto: Pablo Schäfer<br />
Schopftintling Foto: Klaus Bornstedt<br />
29