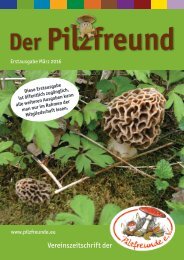Der Pilzfreund - Ausgabe 4
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Unter einem Hut<br />
und Porphyrwulstlinge (Amanita porphyria), der potentiell<br />
stark giftige Igelwulstling (Amanita solitaria). Und<br />
einige weitere Arten, die im Vergleich dazu eher schwach<br />
giftig sind, wie Fliegenpilz (Amanita muscaria) oder Gelber<br />
Knollenblätterpilz (Amanita citrina).<br />
Es lohnt sich aber, in dieser Gattung genauer hinzusehen,<br />
denn auch der eine oder andere gute und gut erkennbare<br />
Speisepilz hält sich hier versteckt. Am besten geht man<br />
aber zunächst auf „Giftpilzjagd“, um wenigstens den Grünen<br />
Knollenblätterpilz, den Pantherpilz und vielleicht<br />
ein paar weitere der giftigen Arten kennen zu lernen. Die<br />
oben erwähnten Arten sind in Deutschland (mit Ausnahme<br />
des seltenen Igelwulstlings) allesamt häufig, wenn<br />
auch nicht in jeder Gegend. Die Gattungsbestimmung<br />
sollte auch hier die Grundlage sein, wie bereits im ersten<br />
Teil der Serie („Giftpilze“) dargestellt.<br />
Die Scheidenstreiflinge bilden eine eigene Sektion innerhalb<br />
der Wulstlinge. Sie grenzen sich dadurch ab, dass sie<br />
niemals ein Teilvelum ausbilden (also nie einen Ring) und<br />
immer (auch jung schon) einen gerieften Hutrand haben.<br />
Die Stielbasis ist auf keinen Fall keulig oder knollig verdickt,<br />
sondern immer zylindrisch oder auch verjüngt. Sie<br />
ist stets von einer häutigen Scheide umgeben, dem Rest<br />
der Gesamthülle, von der ganz junge Fruchtkörper völlig<br />
umschlossen sind. Hier sollte man ein wenig üben, um<br />
Scheidenstreiflinge sicher erkennen zu können. Denn<br />
in dieser Sektion befindet sich keine einzige giftige Art.<br />
Theoretisch sind die Scheidenstreiflinge der schwierigste<br />
Bereich der Wulstlinge, Artbestimmungen sind häufig<br />
nur mikroskopisch möglich, gelegentlich auch dann nicht.<br />
Wie bei Täublingen oder Champignons ist aber die exakte<br />
Bestimmung nicht wichtig für den Verzehr. Die meisten<br />
Scheidenstreiflinge schmecken – sagen wir mal bescheiden.<br />
Ich würde nicht direkt „schlecht“ sagen, aber viele<br />
Arten sind kein Hochgenuss. Eine erstaunliche Ausnahme<br />
bildet hier der Safran-Streifling (Amanita crocea). Diese<br />
Art ist durch ihren orangegelben Hut und den grob genatterten<br />
Stiel sowie die immer rein weiße Stielscheide ohne<br />
ockerliche oder graue Flecken recht gut zu erkennen. <strong>Der</strong><br />
Safran-Streifling ist hervorragend im Geschmack. Es lohnt<br />
sich, einige dieser Pilze und einige Fuchsige Streiflinge<br />
(Amanita fulva) zu sammeln, in zwei getrennten Pfännchen<br />
zuzubereiten und direkt zu vergleichen.<br />
Bei den Wulstlingen mit Teilvelum (also Ring am Stiel<br />
bei geöffnetem Hut) kommt in Mitteleuropa im Grunde<br />
nur eine Art als regelmäßiger Speisepilz in Frage, nämlich<br />
der Perlpilz (Amanita rubescens). Diese sehr häufige<br />
Art schmeckt sehr gut, ist nicht schwer zu erkennen und<br />
kann auch in den Sommermonaten, in denen sonst kaum<br />
etwas im trockenen Wald wächst, einen Korb füllen. <strong>Der</strong><br />
gefährlichste Doppelgänger ist der Pantherpilz (Amanita<br />
pantherina). Diesen ein paar Mal gefunden und bestimmt<br />
zu haben, gibt Sicherheit und man kann mit gutem Gefühl<br />
die erste Perlpilz-Mahlzeit genießen.<br />
Das wichtigste Merkmal steckt schon im lateinischen Namen<br />
des Perlpilzes: Rubescens. Das Fleisch dieser Art rötet<br />
also. Nicht auf die Weise, wie das die rötenden Champignons<br />
tun würden, sondern es geschieht viel langsamer.<br />
Dafür sind die roten Verfärbungen meist schon beim Auffinden<br />
gut erkennbar: An Kratz- oder Fraßspuren am Stiel,<br />
an den Madengängen in der Stielbasis (Längsschnitt), im<br />
oberen Hutfleisch beim Abziehen der Huthaut. Einige weitere<br />
Merkmale runden das Gesamtbild des Perlpilzes im<br />
Vergleich zum Pantherpilz ab: <strong>Der</strong> oberseits geriefte Ring<br />
(beim Panther oberseits glatt), der (fast immer) ungeriefte<br />
Hutrand (beim Panther ab einem gewissen Alter stets<br />
gerieft), die rundlich-knollige Stielbasis mit mehr oder<br />
weniger groben Velumbändern – aber ohne die dicken,<br />
stulpenartigen Wülste wie beim Pantherpilz. Die Merkmale<br />
„Ringriefung“ + „Hutrandriefung“ + „Stielbasis“ sind<br />
jeweils für sich nicht brauchbar für eine sichere Bestimmung.<br />
Aber in der Kombination ergeben sie Sinn, um sich<br />
zusätzlich zum Röten abzusichern.<br />
Im mediterranen Raum kommen weitere leckere Wulstlinge<br />
vor, die aber in Mitteleuropa gar nicht oder nur sehr<br />
sporadisch vorkommen, so wie der Kaiserling (Amanita<br />
caesarea) oder der Eierwulstling (Amanita ovoidea). Auch<br />
der Fransige Wulstling (Amanita strobiliformis) ist eher<br />
eine mediterrane Art, aber in Deutschland in wärmeren<br />
Gegenden mittlerweile durchaus verbreitet. Auch diese<br />
Art gilt als guter Speisepilz, taucht aber mehr in Einzelfruchtkörpern<br />
oder kleinen Gruppen auf. Die Art ist durch<br />
die großen Fruchtkörper mit dem kleiig-wattigen, sehr<br />
groben Velum erkennbar, das beim Aufschirmen des Hutes<br />
gerne in Fransen oder Fetzen am Hutrand hängen bleibt.<br />
Einen richtigen, gut abgesetzten Ring hat der Pilz nicht,<br />
Safran-Streifling Foto: Pablo Schäfer<br />
Perlpilz Foto: Peter Heimburger<br />
33