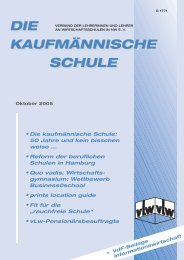DIE KAUFMÄNNISCHE SCHULE DIE KAUFMÄNNISCHE SCHULE
DIE KAUFMÄNNISCHE SCHULE DIE KAUFMÄNNISCHE SCHULE
DIE KAUFMÄNNISCHE SCHULE DIE KAUFMÄNNISCHE SCHULE
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Familienpolitik in Deutschland:<br />
In knapp 50 Jahren wird Deutschland 13<br />
Millionen Menschen weniger zählen als<br />
heute, darunter aber deutlich mehr<br />
Bundesbürger im Seniorenalter. Zugleich<br />
stehen dem Arbeitsmarkt derzeitigen<br />
Prognosen zufolge rund ein Viertel weniger<br />
Arbeitskräfte zur Verfügung. Das<br />
bedeutet unweigerlich Wohlstandsverlust<br />
– es sei denn, der Nachwuchs macht<br />
durch eine bessere Qualifikation einen<br />
deutlichen Leistungssprung. Darüber<br />
hinaus muss die staatliche Familienpolitik<br />
die Weichen so stellen, dass sich hierzulande<br />
möglichst bald wieder mehr junge<br />
Menschen ihren Kinderwunsch erfüllen.<br />
1 Perspektive bis 2050<br />
Im Jahr 2050 steckt Deutschland mitten<br />
in der Midlifecrisis. Binnen eines halben<br />
Jahrhunderts wird das Durchschnittsalter<br />
der Bevölkerung um 8 Jahre auf 45 Lenze<br />
geklettert sein. Zugleich wird es leerer im<br />
Land werden. Mit etwa 69 Millionen Einwohnern<br />
rechnen die Bevölkerungswissenschaftler<br />
in 45 Jahren.<br />
Die bundesdeutsche Gesellschaft altert<br />
und sie schrumpft. Dass die Menschen<br />
älter werden, ist dem medizinischen Fortschritt<br />
zu verdanken. Dass es deutlich<br />
weniger junge Leute gibt, hat andere<br />
Ursachen:<br />
Quelle: IWD Nr. 45 (04.11.2004), S. 4<br />
Mehr Eltern braucht das Land<br />
Deutsche Geburtenrate liegt aber nur bei etwa 1,4 Kindern<br />
Im Schnitt müsste jede Frau 2,1 Kinder<br />
zur Welt bringen, damit die Einwohnerzahl<br />
konstant bleibt – und das schon seit<br />
30 Jahren.<br />
Die Zahl der Menschen im arbeitsfähigen<br />
Alter zwischen 15 und 65 Jahren wird<br />
zwischen Ostsee und Bodensee von<br />
heute 55 Millionen Erwerbsfähigen auf 39<br />
Millionen im Jahr 2050 zurückgehen.<br />
Wenn weniger Menschen arbeiten, können<br />
aber weniger Güter und Dienstleistungen<br />
produziert werden. Zugleich<br />
müssen davon mehr nicht arbeitende<br />
Einwohner mitversorgt werden. Schon in<br />
der Vergangenheit verschlechterte sich<br />
das Verhältnis von potenziellen Arbeitskräften<br />
zu Nicht-Erwerbsfähigen in kaum<br />
einem Industrieland so krass wie in<br />
Deutschland (vgl. Abb. 1).<br />
Von 1991 bis 2003 erhöhte sich die Zahl<br />
der Erwerbsfähigen im Alter zwischen 15<br />
und 65 Jahren nur marginal um 0,7 Prozent.<br />
Die Gruppe der noch nicht oder<br />
nicht mehr im Arbeitsleben Stehenden<br />
vergrößerte sich dagegen um 7,5 Prozent.<br />
Mehr Probleme mit dem ausbleibenden<br />
Nachwuchs als Deutschland<br />
haben unter den Industrieländern nur<br />
Spanien, Portugal, Irland und Italien.<br />
Anders sieht es in den USA aus: Dort ist<br />
die Bevölkerungsstruktur der deutschen<br />
heute zwar noch vergleichbar. Aufgrund<br />
der hohen Geburtenraten und der<br />
Zuwanderung wird es zwischen New<br />
York und Los Angeles jedoch keine solchen<br />
Generationsumschichtungen geben<br />
wie in „good old Germany“.<br />
So kommen in Deutschland zurzeit auf<br />
zehn Erwerbsfähige rund fünf Menschen<br />
im nicht erwerbsfähigen Alter – vor 20<br />
Jahren waren es nur vier, 2050 werden es<br />
bereits knapp acht sein. Der Generationenvertrag<br />
lässt sich so nicht mehr einlösen.<br />
An zwei Hebeln muss daher angesetzt<br />
werden, um die negativen Folgen<br />
des demografischen Wandels für die<br />
Erwerbstätigkeit und damit den Wohlstand<br />
zu mildern:<br />
� Zahl der Arbeitskräfte:<br />
Ein größerer Teil der Bevölkerung muss in<br />
Arbeit gebracht werden, etwa über kürzere<br />
Ausbildungszeiten, einen späteren<br />
Ruhestand und eine verstärkte Frauenerwerbstätigkeit.<br />
Der Arbeitskräftepool<br />
würde sich auch wieder füllen, wenn<br />
mehr Kinder geboren werden.<br />
� Qualifikation der Arbeitskräfte:<br />
Das Ausbildungsniveau der Erwerbstätigen<br />
muss gesteigert werden, denn dann<br />
können sie mehr erwirtschaften.<br />
Familie und Beruf<br />
Zwei Kinder – bereits über dem Durchschnitt<br />
2 Eine Neuorientierung<br />
Eine neu justierte Familienpolitik setzt an<br />
beiden Punkten an. Sie hat zum Ziel,<br />
Hintergrund:<br />
Sozialstatistik<br />
Insgesamt hat ein Drittel der Männer<br />
zwischen 25 und 54 Jahren (noch)<br />
keine eigenen Kinder.<br />
� Aufgeschoben, nicht aufgehoben:<br />
Männer mit hoher Qualifikation<br />
oder langer Ausbildung werden oft<br />
jenseits der 35 Väter.<br />
� Keine Kohle, keine Kinder: 38 %<br />
der Männer ab 34 mit einem<br />
monatlichen Nettoeinkommen<br />
unter 1.500 Euro sind kinderlos.<br />
Nur 11 % sind es, wenn 2.500 Euro<br />
und mehr verdient werden.<br />
� Väter arbeiten zuviel: 88 % der 25bis<br />
54-Jährigen arbeiten Vollzeit,<br />
ein Drittel über 45 Stunden. 44 %<br />
haben in den drei Jahren nach der<br />
Geburt ihr berufliches Engagement<br />
erhöht.<br />
Weitere Informationen unter www.<br />
maennerleben.de<br />
Rheinische Post (15.01.2005), S. A7 ❍<br />
<strong>DIE</strong> <strong>KAUFMÄNNISCHE</strong> <strong>SCHULE</strong> 2/2005 15