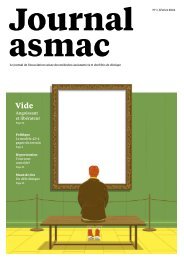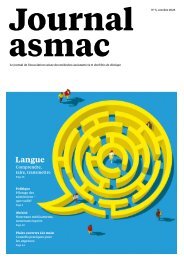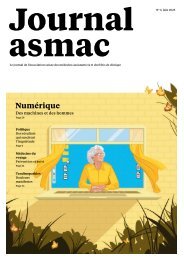vsao Journal Nr. 4 - August 2021
Spannung- Von Masten bis Muskeln Nephrologie - Zystennieren – ein schwieriges Erbe Analgetika - Neuropathische Schmerzen Politik - Medizin und Klimaschutz
Spannung- Von Masten bis Muskeln
Nephrologie - Zystennieren – ein schwieriges Erbe
Analgetika - Neuropathische Schmerzen
Politik - Medizin und Klimaschutz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Fokus<br />
Schmetterlinge<br />
im Kopf<br />
Wenn es vor einem Auftritt nicht im Bauch flattert, sondern in Kopf<br />
und Magen, hat man Lampenfieber. Das trifft nicht nur jene, die im<br />
Rampenlicht stehen, sondern viele, die etwas präsentieren müssen.<br />
Es gibt Wege, damit positiv umzugehen.<br />
Julia Heinrichs Diplompsychologin, Regisseurin und Trainerin für<br />
Kommunikation und Auftrittskompetenz. www.facetta.ch<br />
Gäbe es kein Lampenfieber,<br />
bräuchte es auch keine Souffleusen<br />
und die Welt des Theaters<br />
wäre vielleicht eine andere.<br />
Es ist kein Zufall, dass die Ursprünge<br />
des in Frankreich seit Mitte des 19. Jahrhunderts<br />
gebräuchlichen Ausdrucks<br />
«fièvre de rampe», im Deutschen auch<br />
«Rampenfieber», der Theaterwelt zugeschrieben<br />
werden und er im Jargon der<br />
Schauspieler für die Aufregung vor dem<br />
Auftritt steht.<br />
Die Herkunft des Begriffs könnte aber<br />
auch technischer geprägt sein, da die<br />
Gaslampen, die die Theaterbühne beleuchteten,<br />
die Darstellerinnen und Darsteller<br />
durch ihre Hitze zu Schweissausbrüchen<br />
getrieben haben. Die meisten<br />
Bühnenkünstler, wie Sänger, Musikerinnen,<br />
Schauspielerinnen und Tänzer, erleben<br />
vor ihrem Auftritt Symptome von<br />
Nervosität, Aufregung, Stress, Anspannungen<br />
oder auch Eustress.<br />
Heute wird Lampenfieber umgangssprachlich<br />
in vielen Situationen verwendet,<br />
bei denen sich jemand meistens vor<br />
einer Gruppe Menschen exponiert, um<br />
eine bewertbare Leistung zu erbringen.<br />
Das kann die Situation vor einer Kamera<br />
sein, ein Bewerbungsgespräch, ein Referat,<br />
oder auch eine Ansprache bei einer<br />
Familienfeier – Ereignisse, bei denen viele<br />
Menschen Versagensängste haben. In der<br />
psychologischen Forschung werden unter<br />
dem Begriff «performance anxiety» neben<br />
Lampenfieber auch Formen wie z. B. «Auftrittsangst»,<br />
«Podiumsangst», «Vorstartangst»<br />
(im Sport) und «Kanonenfieber»<br />
(befällt u. U. Soldaten) untersucht.<br />
Vom Kribbeln zur Panik<br />
In diesen Situationen treten ganz archaische<br />
Phänomene auf. Je nachdem, wie wir<br />
die Situation – meist unbewusst – bewerten,<br />
kann aus einem positiven leichten<br />
Kribbeln – ähnlich dem Gefühl von Verliebtheit<br />
– eine Panikattacke werden. Dazu<br />
reicht mitunter die Anwesenheit einer<br />
bestimmten Person z. B. eines Kritikers.<br />
Zum Glück ist Lampenfieber aber kein<br />
grundlegender Charakterzug, sondern –<br />
im ausgeprägten Zustand – ein vorübergehender<br />
Angstzustand oder eine soziale<br />
Phobie, die sich in bestimmten, individuell<br />
wahrgenommenen Situationen als<br />
Herausforderung zeigt.<br />
Das physisch und psychisch spürbare<br />
positive Phänomen des Lampenfiebers<br />
äussert sich in Form vermehrter Neurotransmitter-<br />
und Stresshormonausschüttung.<br />
Der Körper reagiert mit Erhöhung<br />
des Cortisol- und des Adrenalinspiegels,<br />
die die Durchblutung in Gehirn und Muskeln<br />
fördern. Das führt zu gesteigerter<br />
Konzentration und Fokussierung, schneller<br />
Reaktionsfähigkeit, grosser Wachheit<br />
und Präsenz in einem produktiven Energielevel.<br />
Vor langer Zeit wurde im Yerkes-<br />
Dodson-Gesetz beschrieben, dass zwischen<br />
der physiologischen Aktivierung<br />
und der Leistungsfähigkeit ein umgekehrt<br />
U-förmiger Zusammenhang besteht.<br />
Demzufolge führt zu viel Lampenfieber<br />
zu negativ konnotierten Symptomen wie<br />
feuchten Händen, zittriger Stimme (oft<br />
höher werdend), weichen Knien, innere<br />
Unruhe, eventuell Übelkeit, Bauchschmerzen,<br />
Durchfall, Vergesslichkeit bis<br />
hin zum Blackout. Obwohl es uns völlig<br />
klar ist, dass es keine reale Bedrohung<br />
gibt, hat der Kopf in diesem Moment keinen<br />
direkten Zugriff auf den Körper und<br />
keine oder nur eine eingeschränkte Kontrollmöglichkeit<br />
über ihn. Die vermeintliche<br />
Gefahrensituation hat unser Reptilienhirn<br />
aktiviert, und wir sind mit den<br />
entsprechenden körperlichen Reaktionen<br />
auf Flucht oder Kampf vorbereitet. Dem<br />
Grosshirn ist klar, dass weder Flucht noch<br />
Kampf nötig sind, trotzdem fürchtet sich<br />
die Person. Die Furcht kann zu tonischer<br />
Immobilität führen, um sich vor dem vermeintlichen<br />
Angreifer tot zu stellen. Dies<br />
wird oft als lähmender, hilfloser und<br />
blockierender Zustand auf der Bühne beschrieben.<br />
So ist es nicht verwunderlich,<br />
dass in der darstellenden Kunst häufig zu<br />
äusseren Mitteln gegriffen wird, um das<br />
überschüssige Lampenfieber in den Griff<br />
zu bekommen. Während Doping im Sport<br />
mittlerweile moralisch verwerflich ist,<br />
werden Drogen, Alkohol und Medikamente<br />
in der Bühnenkunst immer noch weitgehend<br />
tabuisiert statt thematisiert. Dabei<br />
wird je nach Branche auf etwas anders zugegriffen.<br />
Gerade im Theater nehme ich<br />
eine Abnahme von Drogen- (u. a. Kokain,<br />
Alkohol) und eine Zunahme von Medika-<br />
32 4/21 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>