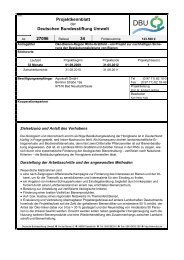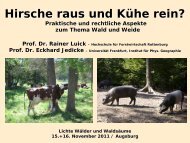Download als PDF (Gesamtbroschüre): 4,7 MB - Prof. Dr. Eckhard ...
Download als PDF (Gesamtbroschüre): 4,7 MB - Prof. Dr. Eckhard ...
Download als PDF (Gesamtbroschüre): 4,7 MB - Prof. Dr. Eckhard ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Offenhaltung von Steintriften für die<br />
Berghexe und das Bundesgroßprojekt<br />
„Thüringer Rhönhutungen“<br />
Von Julia Gombert und Petra Ludwig<br />
Seit 1979 besteht das Programm des<br />
Bundesamtes für Naturschutz (BfN) zur<br />
„Errichtung und Sicherung schutzwürdiger<br />
Teile von Natur und Landschaft mit<br />
gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung“.<br />
Das Förderprogramm soll zum<br />
dauerhaften Erhalt von Naturlandschaften<br />
sowie zur Sicherung und Entwicklung<br />
von Kulturlandschaften mit herausragenden<br />
Lebensräumen zu schützender<br />
Tier- und Pflanzenarten beitragen.<br />
In der Rhön handelt es sich um das<br />
zweite bewilligte Naturschutzgroßprojekt:<br />
Bereits von 1981 bis 1995 wurde im<br />
bayerischen Teil der Rhön das Naturschutzgroßprojekt<br />
„Hohe Rhön/Lange<br />
Rhön“ umgesetzt. Das Bundesgroßprojekt<br />
„Thüringer Rhönhutungen“ ist mit<br />
den Projekten am Kyffhäuser und im<br />
mittleren Saaletal das dritte seiner Art in<br />
Thüringen. Um in das Bundesförderprogramm<br />
aufgenommen zu werden, sind die<br />
Kriterien Repräsentanz, Großflächigkeit,<br />
Naturnähe, Gefährdung und Beispielhaftigkeit<br />
entscheidend.<br />
In Folge einer Jahrhunderte langen kontinuierlichen<br />
Schafbeweidung entstand<br />
in der Thüringischen Vorderrhön ein<br />
deutschlandweit einzigartiger Verbund<br />
an Magerrasen und Hutungsbändern auf<br />
Muschelkalk. Bis Anfang der 1990er<br />
Jahre befanden sich diese ausgedehnten<br />
Flächen, zu denen auch gehölzfreie Steintriften,<br />
Wacholderheiden sowie parkartige<br />
Hutewälder auf Kalkmagerrasen gehören,<br />
in einem hervorragenden Pflegezustand.<br />
Die geänderten Rahmenbedingungen seit<br />
Anfang der 1990er Jahre haben für die<br />
Landwirtschaft Einfluss auf die Bewirtschaftung<br />
der Kalkmagerrasen. Vor<br />
allem der Rückgang des Gesamtschafbestandes,<br />
die geänderten Ansprüche an<br />
die Schafhaltung und die Abnahme der<br />
Rinderbestände in der Region und damit<br />
die Verfügbarkeit fetteren Grünlands für<br />
die Schafherden haben eine nachlassende<br />
Nutzung der Kalkmagerrasen zur Folge.<br />
Daraus resultiert eine zunehmende Verbuschung<br />
auf den ehem<strong>als</strong> fast gehölzfreien<br />
Flächen.<br />
Um den repräsentativen Kalkmagerrasenkomplex<br />
zu erhalten und zu entwickeln<br />
sowie die dafür notwendigen Rahmenbedingungen<br />
für die Pflegeschäferei<br />
zu verbessern, wurde bereits Mitte der<br />
1990er Jahre eine erste Antragsskizze<br />
an das Bundesamt für Naturschutz zur<br />
Aufnahme in das Bundesförderprogramm<br />
gestellt. Nachdem das BfN im Jahr 2002<br />
neue Förderelemente in das Programm<br />
für Naturschutzgroßprojekte aufgenommen<br />
hatte, die unter anderem die Finanzierung<br />
von schäfereilicher Infrastruktur<br />
ermöglichen, wurde das Projekt 2003<br />
gestartet.<br />
Die besondere Bedeutung des Erhalts der<br />
Kalkmagerrasen zeigt der Schutzstatus in<br />
Thüringen, die Erfassung im Bundesnaturschutzgesetz<br />
und in der FFH-Richtlinie<br />
der EU.<br />
Die Bedeutung des Erhalts der naturnahen<br />
Kalk-Trockenrasen für unzählige<br />
Wärme liebende Arten soll anhand der<br />
Tagfalterart Berghexe (Chazara briseis)<br />
gezeigt werden.<br />
Artenschutz für die Berghexe<br />
Im Zeitraum von 2001 bis 2004 förderte<br />
die Zoologische Gesellschaft Frankfurt<br />
(ZGF) das Projekt zur Erhaltung bzw.<br />
Wiederherstellung des bedeutenden Vorkommens<br />
von C. briseis in der Thüringer<br />
Vorderrhön am Südhang der Hohen Geba.<br />
Die Berghexe ist eine in Südosteuropa<br />
und in Nordafrika verbreitet Tagfalterart.<br />
In Deutschland kommt diese stark gefährdete<br />
Art in den Bundesländern Baden-<br />
Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz,<br />
Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und<br />
Nordrhein-Westfalen vor. Überwiegend<br />
trägt sie den Rote-Liste-Status „stark<br />
gefährdet“. Sie ist auf heiße, trockene<br />
und mit Felsen durchsetzten Magerrasen<br />
angewiesen. Der Erhalt des Biotops<br />
(geeignete Pflege zur Vermeidung von<br />
Verbuschung) ist die einzige Möglichkeit,<br />
die Art dauerhaft zu erhalten.<br />
In Thüringen wurde die Berghexe im<br />
Norden am Kyffhäuser und in Südthüringen<br />
nachgewiesen. Die Population am<br />
Südhang der Hohen Geba zählt zu den<br />
individuenreichsten in ganz Deutschland.<br />
Hier in Südthüringen liegt der Verbreitungsschwerpunkt<br />
der Berghexe, was die<br />
besondere Verantwortung zum Erhalt<br />
dieser Art unterstreicht.<br />
Durch oben genannte Nutzungsänderungen<br />
veränderte sich der Lebensraum am<br />
Südhang der Hohen Geba. Vor allem der<br />
zunehmende Schlehen- und Nadelgehölzaufwuchs<br />
bedrohten die Population.<br />
In den Winterhalbjahren 2001/2002 und<br />
2002/2003 wurden im Rahmen des Pro-<br />
2 3