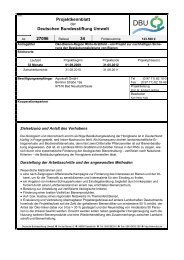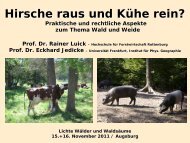Download als PDF (Gesamtbroschüre): 4,7 MB - Prof. Dr. Eckhard ...
Download als PDF (Gesamtbroschüre): 4,7 MB - Prof. Dr. Eckhard ...
Download als PDF (Gesamtbroschüre): 4,7 MB - Prof. Dr. Eckhard ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fressen für den Naturschutz –<br />
großflächig-extensive Beweidung in der Rhön<br />
Von <strong>Eckhard</strong> Jedicke, Karl-Heinz Kolb und Katja Preusche<br />
1. Einleitung<br />
Das von der Deutschen Bundesstiftung<br />
Umwelt von 2005 bis 2008 geförderte<br />
Projekt „Grünlandschutz und Landschaftsentwicklung<br />
durch großflächige<br />
Beweidung im Biosphärenreservat Rhön“<br />
unter Trägerschaft der Regionalen Arbeitsgemeinschaft<br />
(ARGE) Rhön erprobt<br />
Formen der extensiven, teils ganzjährigen<br />
Beweidung auf zusammenhängenden<br />
Flächen von > 10 ha bis > 100 ha. Es<br />
soll helfen, eine flächendeckende Landnutzung<br />
<strong>als</strong> Grundlage für Naturschutz,<br />
Landwirtschaft und Tourismus zu erhalten<br />
und zu fördern.<br />
Ausgangssituation und Motivation für<br />
das Projekt bilden unsichere Zukunftsaussichten<br />
für die Aufrechterhaltung der<br />
Grünland-Bewirtschaftung aufgrund Flächenzersplitterung<br />
(insbesondere infolge<br />
der fränkischen Realerbteilung in der<br />
bayerischen Rhön), ungeklärter Hofnachfolge<br />
und Umbrüchen durch Umsetzung<br />
der EU-Agrarpolitik. Das Projekt soll exemplarisch<br />
zeigen, wie eine Win-win-Situation<br />
für Landwirtschaft, Naturschutz<br />
und Tourismus realisiert und eine an die<br />
Naturschutzziele angepasste Grünlandnutzung<br />
aufrechterhalten werden kann.<br />
Ziel ist die Erprobung einer großflächigen,<br />
extensiven und teilweise ganzjährigen<br />
Beweidung, deren Auswirkungen durch<br />
ein sozio-ökonomisches und naturschutzfachliches<br />
Monitoring analysiert werden.<br />
Zur Verbesserung der ökonomischen<br />
Situation bilden auch Initiativen zur Vermarktung<br />
einen Bestandteil des Projekts.<br />
Vier Bausteine werden realisiert:<br />
• Beratung: Zwei in Teilzeit beschäftige<br />
Projektmanager informieren, beraten<br />
und vernetzen die Akteure.<br />
• Modellösungen: In Projektkernen<br />
werden unterschiedliche Weidemodel-<br />
le realisiert, die Resultat der intensiven<br />
Beratung sind.<br />
• Vermarktung: Die erzeugten Produkte<br />
werden nach Möglichkeit über beste-<br />
hende Vermarktungswege vertrieben;<br />
wo Lücken erkannt werden, werden<br />
auch eigene Produkte kreiert.<br />
• Monitoring: Eine sozioökonomische<br />
und naturschutzfachliche Analyse liefert<br />
Rahmendaten über die Auswirkungen<br />
der Beweidung und wird Grundlage<br />
sein für die Ausdehnung dieser Bewei-<br />
dungsmodelle.<br />
2. Projektorganisation<br />
Als Kooperationspartner sind 13 Institutionen<br />
beteiligt: die Verwaltungsstellen<br />
des Biosphärenreservats, Bauernverbände,<br />
Behörden der Landwirtschaft und des<br />
Naturschutzes sowie die Zoologische<br />
Gesellschaft Frankfurt. Während die<br />
Kooperationspartner einmal jährlich<br />
tagen, finden auf landesspezifischer Ebene<br />
bedarfsweise Besprechungen statt. Das<br />
Projektmanagement ist – selten für ein<br />
Naturschutzprojekt, aber effizient in der<br />
Umsetzung – beim Bayerischen bzw.<br />
Hessischen Bauernverband angesiedelt.<br />
Zur Verfügung steht eine halbe und eine<br />
Zwei-<strong>Dr</strong>ittel-Person<strong>als</strong>telle plus ein Ausbildungsplatz.<br />
3. Beratung von Landwirten und<br />
Weidegemeinschaften<br />
Die teilnehmenden Landwirte und<br />
Weidegemeinschaften erhalten zu verschiedensten<br />
Fragestellungen Beratung<br />
– durch die Projektmanager, die fallweise<br />
bei speziellen Fragestellungen Kooperationspartner<br />
und weitere Fachleute<br />
hinzuziehen. Thematisiert werden insbesondere<br />
folgende Punkte:<br />
• Besatzdichte/-stärke und Beweidungs-<br />
zeiten, die den jeweiligen Standortei-<br />
genschaften, wie Vegetation und Bo-<br />
denverhältnissen, angemessen er-<br />
scheinen (Ganzjahresbeweidung, früher<br />
Auftrieb und später Abtrieb etc.).<br />
• Zaun- und Tränkenbau (Art, Kosten,<br />
Material, Bauweise, Funktionstüchtig-<br />
keit – auch im Winter, Hütesicherheit<br />
für verschiedene Tierarten, Verbot von<br />
Stacheldraht, Verträglichkeit für die Avifauna,<br />
keine neuen Quellfassungen etc.).<br />
• Möglichkeiten von Wegequerungen:<br />
Auch über die Möglichkeiten von Wei-<br />
degitterrostanlagen wird informiert,<br />
wenn eine Weideflächenvergrößerung<br />
über einen Weg hinweg in Frage kommt.<br />
• Gesundheits- und Parasitenmanage-<br />
ment: Über spezifische Aspekte der<br />
Tiergesundheit auf extensiven Groß-<br />
weiden und bei Multi-Spezies-Beweidung<br />
unterrichtete ein Tierarzt bei ei-<br />
nem Infoabend. Zu diesem Themen-<br />
komplex wurden zwei studentische Ar-<br />
beiten angefertigt. Die Landwirte erhalten<br />
Hinweise auf mögliche Gesund-<br />
heits-Risiken bei Änderungen der Be-<br />
weidung (z.B. wenn die Weide künftig<br />
mit einer weiteren Tierart bestoßen<br />
werden soll), die diese dann im Ge-<br />
spräch mit ihrem Hoftierarzt abklärten.<br />
• neue bzw. veränderte Agrarumweltpro-<br />
gramme und jeweilige Teilnahmemög-<br />
lichkeiten.<br />
• Wirtschaftlichkeitsberechnungen und<br />
- beratungen für Einzellandwirte, bestehende<br />
und geplante Weidegemeinschaften.<br />
3 3