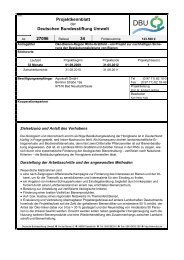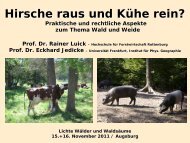Download als PDF (Gesamtbroschüre): 4,7 MB - Prof. Dr. Eckhard ...
Download als PDF (Gesamtbroschüre): 4,7 MB - Prof. Dr. Eckhard ...
Download als PDF (Gesamtbroschüre): 4,7 MB - Prof. Dr. Eckhard ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
werden in Kürze einen Kooperationsvertrag<br />
abschließen. Alle werden bereits seit<br />
2005 durch die Projektmanager beraten.<br />
Daneben gibt es weitere Landwirte, die<br />
grundsätzlich am Projekt interessiert<br />
sind, bei denen sich jedoch noch keine<br />
klare Aussage über eine Projektteilnahme<br />
treffen lässt. Die Projektmanager erhalten<br />
auch bis dato weiterhin neue Anfragen<br />
von Landwirten, die ggf. am Projekt teilnehmen<br />
möchten.<br />
Mit Stand von November 2007 sind 558 ha<br />
Weidefläche Bestandteil des Grünlandprojekts,<br />
verteilt auf 20 Einzelflächen, die<br />
von 13 Einzelbetrieben und neun Weidegemeinschaften<br />
bewirtschaftet werden.<br />
Beteiligt sind insgesamt 59 Landwirte.<br />
Durch weitere Abschlüsse wird sich die<br />
Weidefläche voraussichtlich im Laufe des<br />
Jahres auf knapp 850 ha erhöhen. Damit<br />
wird das im Antrag formulierte Ziel aller<br />
Voraussicht nach erreicht, zum Ende des<br />
Projektes 800 ha Weideflächen <strong>als</strong> großflächige<br />
Standweiden zu bewirtschaften.<br />
Eingesetzt werden Rinder, Ziegen, Pferde<br />
und Schafe, wobei die Rinder überwiegen.<br />
Teilweise wird Mischbeweidung praktiziert.<br />
Fünf Landwirte und Weidegemeinschaften<br />
betreiben mittlerweile Ganzjahresfreilandhaltung<br />
auf ca. 185 Hektar Weidefläche<br />
mit unterschiedlichen Rinderrassen.<br />
Weitere Landwirte sind grundsätzlich an<br />
der Ganzjahresfreilandhaltung interessiert.<br />
Wie schnell sich auf weiteren<br />
Weideflächen die Winterfreilandhaltung<br />
realisieren lässt, kann momentan noch<br />
nicht abgeschätzt werden. In Hessen sind<br />
zwingend Weideunterstände vorgeschrieben,<br />
deren Bau eine längere Vorbereitungsphase<br />
erfordert.<br />
5. Freiwilliger Flächennutzungstausch<br />
In weiten Bereichen der bayerischen<br />
Rhön und ihrem Vorland herrscht durch<br />
die dort seit Generationen praktizierte<br />
fränkische Realerbteilung eine starke Besitzzersplitterung.<br />
In vielen Gemarkungen<br />
hat zudem noch nie eine Flurbereinigung<br />
stattgefunden. Aus diesem Grund finden<br />
sich in diesen Gebieten nur sehr klein<br />
parzellierte Fluren, in denen die Einrichtung<br />
von großflächigen, zusammenhängenden<br />
Weideflächen ≥ 10 ha sehr<br />
schwierig zu realisieren ist.<br />
Der Bayerische Bauernverband (BBV)<br />
führt daher im Auftrag des Amtes für<br />
Ländliche Entwicklung (ALE) Würzburg<br />
in der Rhön Verfahren zum Freiwilligen<br />
Flächennutzungstausch (FNT) durch.<br />
Getauscht wird hierbei die Bewirtschaftung<br />
der einzelnen Flächen, die Eigentumsverhältnisse<br />
bleiben unangetastet.<br />
Der FNT bildet ein geeignetes Flurneuordnungsinstrument,<br />
mit dem in kurzer<br />
Zeit (Verfahrensdauer 1-2 Jahre) eine<br />
deutliche Erhöhung der Flächengrößen<br />
(Feldstücke) erreicht sowie eine Zusammenlegung<br />
der Flächen jeweils eines<br />
Bewirtschafters in einen oder wenige<br />
Bereiche der Flur umgesetzt werden<br />
kann. Ein solches Tauschverfahren erfolgt<br />
auf freiwilliger Basis und ist auf einen<br />
Zeitraum von zehn Jahren ausgelegt.<br />
Zur Erzeugung optimaler Synergieeffekte<br />
zwischen dem freiwilligem Flächennutzungstausch<br />
und dem DBU-Grünlandprojekt<br />
arbeitet einer der Projektmanager<br />
jeweils mit einer halben Stelle im FNT<br />
und im Grünlandprojekt Rhön. Über den<br />
FNT gelang es dem Projektmanager, in<br />
Gemarkungen mit stark zersplitterten Besitzverhältnissen<br />
Flächen für großflächige,<br />
extensive Weiden zusammenzulegen. Das<br />
konkrete Ergebnis des FNT sind die derzeit<br />
entstehende Weidegemeinschaften in<br />
den Gemarkungen Sandberg/Schmalwasser<br />
und Eckarts/Rupboden: In Sandberg<br />
haben sieben Landwirte, darunter vier<br />
Junglandwirte, drei Weidegemeinschaften<br />
gebildet. Diese werden nach derzeitigem<br />
Stand zusammen 215 ha (Weidefläche<br />
und Winterfutterfläche) bewirtschaften<br />
und einen einfachen Gemeinschaftsstall<br />
bauen. Geplant ist eine Herde mit 120<br />
Mutterkühen und einer entsprechenden<br />
Anzahl Bullen der Rasse Gelbes Frankenvieh.<br />
In Eckarts entsteht in der Folge des<br />
FNT eine weitere Weidegemeinschaft,<br />
ebenfalls mit Frankenvieh, und rund<br />
90 ha Weidefläche.<br />
Weiterhin laufen in der hessischen und<br />
thüringischen Rhön drei Regelflurbereinigungsverfahren,<br />
in deren Rahmen Beiträge<br />
für das Grünlandprojekt umgesetzt<br />
werden (Pferdskopf und Rodholz/Gemeinde<br />
Poppenhausen, Walkes/Gemeinde<br />
Ketten).<br />
6. Vermarktung<br />
Aufbauend auf einer Diplomarbeit von<br />
Annemarie Lindner über „Standort- und<br />
Vermarktungspotenziale für traditionelle<br />
Nutztierrassen im Biosphärenreservat<br />
Rhön im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung“<br />
wurde ein Vermarktungsworkshop<br />
durchgeführt und auf beider Basis<br />
ein Vermarktungskonzept erstellt.<br />
Bei der Direktvermarktung oder der Vermarktung<br />
an Gastronomiebetriebe von<br />
Rindern sind die sog. Edelteile (Lende,<br />
Roastbeef etc.) relativ unproblematisch<br />
abzusetzen. Schwierig ist dagegen die<br />
Vermarktung der sog. unedlen Teile (Abschnitte,<br />
Fleisch aus den Rippenbögen)<br />
und älterer Tiere. Diese sind nur sinnvoll<br />
über Veredelungsprodukte, <strong>als</strong>o z.B.<br />
<strong>als</strong> Wurst, zu vermarkten. Aus diesem<br />
Sachverhalt heraus wurde die Idee im<br />
Projekt zur Herstellung einer Rindersalami<br />
geboren, die kurz <strong>als</strong> „Salami-Taktik“<br />
umschrieben wird.<br />
Der Produktname steht in direkter Beziehung<br />
zum Produktdesign: Der „Rhön<br />
Schdegge“ symbolisiert einen Wanderstock,<br />
der in Rhöner Mundart „Schdegge“<br />
genannt wird. Dies gewährleistet somit<br />
einen hohen Wiedererkennungswert<br />
und hebt sich deutlich von anderen<br />
Salamis und Hartwürsten ab – zugleich<br />
ein Hinweis auf seine hohe Qualität.<br />
3 5