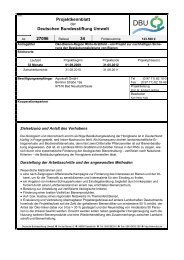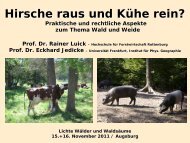Download als PDF (Gesamtbroschüre): 4,7 MB - Prof. Dr. Eckhard ...
Download als PDF (Gesamtbroschüre): 4,7 MB - Prof. Dr. Eckhard ...
Download als PDF (Gesamtbroschüre): 4,7 MB - Prof. Dr. Eckhard ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
a) Auswirkungen der Parasiten-Prophylaxe<br />
auf koprophage Käfer,<br />
b) Einflüsse der Beweidung von Quellbiotopen<br />
und kleinen Fließgewässern<br />
auf ökomorphologische Strukturen und<br />
Biodiversität.<br />
Aufgrund des limitierten Etats können<br />
nicht in die Breite gehende Untersuchungen<br />
realisiert werden, sondern es erfolgt<br />
eine Konzentration auf den zentralen<br />
Vergleich zwischen Wiese und (großflächiger)<br />
Weide. Als zentrale Indikatoren<br />
werden prioritär Vegetation und Vegetationsstruktur,<br />
Vögel und Tagfalter bearbeitet;<br />
hierbei werden möglichst identische<br />
Flächen und Transekte für die verschiedenen<br />
Artengruppen untersucht. Längerfristig<br />
ist die Gehölzentwicklung besonders<br />
interessant, insbesondere auch der<br />
Verbiss durch Tiere (Abb. 3). Durch den<br />
Hessischen Landesverband für Höhlen-<br />
und Karstforschung wurden 2006 auf<br />
Weideflächen aller drei Landesteile der<br />
Rhön im Auftrag der Verwaltungsstellen<br />
des Biosphärenreservats und in Abstimmung<br />
mit dem Projekt die Quellen mit<br />
ihren Strukturen sowie ihrer Flora und<br />
Fauna erfasst (s. Beitrag ZAENKER &<br />
REISS). Außerdem läuft in Zusammenarbeit<br />
mit der Thüringer Landesanstalt<br />
für Umwelt und Geologie eine vergleichende<br />
Untersuchung der Einflüsse der<br />
medikamentösen Parasitenprophylaxe bei<br />
Rindern auf die Besiedlung von Dunghaufen<br />
durch koprophage Käfer.<br />
8. Sozioökonomisches Monitoring<br />
und Beratung<br />
Das Simulationsmodell Green X vom<br />
Institut für Betriebslehre der Agrar- und<br />
Ernährungswissenschaften der Justus-<br />
Liebig-Universität Gießen wurde für die<br />
Erfordernisse des Grünlandprojektes<br />
umgearbeitet und angepasst. Weiterhin<br />
wurde es durch das Einfügen einer Vielzahl<br />
von Verknüpfungen und Formeln<br />
möglich, relativ schnell verschiedene Be-<br />
triebsmodelle automatisiert durchzurechnen.<br />
Somit können die ökonomischen<br />
Effekte verschiedener Weideflächen- und<br />
Herdenbestandsgrößen sowie der Winterbeweidung<br />
untersucht werden. Durch<br />
einen neuen Flächenprämienrechner und<br />
das automatische Ausschalten der alten<br />
Tierprämien wird in Green X jetzt der<br />
aktuellen Subventions- und Fördermittelkulisse<br />
Rechnung getragen. Es lassen sich<br />
Vergleiche der ökonomischen Situation<br />
vor und nach der Agrarreform und der<br />
verschiedenen Bundesländer vornehmen.<br />
Für erste Wirtschaftlichkeitsberechnungen<br />
wurde eine große hessische Weidegemeinschaft<br />
(14 Landwirte, 101 ha Weide)<br />
untersucht, die im Winter 2006/07<br />
erstmalig eine Winterbeweidung auf über<br />
800 m ü. NN Höhe mit Fleckvieh und einem<br />
einfachen selbstgebauten Holzunterstand<br />
mit Futterlager erfolgreich erprobte.<br />
Als anderes projekttypisches Fallbeispiel<br />
wurde ein bayerischer (Einzel-)Landwirt<br />
mit Gelbvieh-Ganzjahrsfreilandhaltung<br />
(ohne Unterstand) in einer Auenlage auf<br />
300 m ü. NN (10 ha Weide) <strong>als</strong> Berechnungsgrundlage<br />
herangezogen.<br />
Deutlich am besten schnitt die Ökobetriebs-Winterweide<br />
mit Färsen- und<br />
Ochsenverkauf ab. Eine um 33 % geringere<br />
Bodenrente (BR) <strong>als</strong> diese erzielte die<br />
Öko-Winterweide mit Absetzerverkauf,<br />
es folgte die Färsen-/Ochsen–Öko-Winterstallhaltung<br />
(37 % geringere BR), die<br />
konventionelle Winterweide mit Absetzern<br />
(46 % geringere BR), dann der Öko-<br />
Winterstall mit Absetzern (56 % geringere<br />
BR), die konventionelle Winterweide<br />
mit Färsen/Ochsen (61 % geringere BR),<br />
der konventionelle Winterstall mit Absetzern<br />
(73 % geringere BR) und zuletzt der<br />
konventionelle Winterstall mit Färsen/<br />
Weideochsen (102 % geringere BR). Der<br />
Verkauf von Färsen und männlichen Absetzern<br />
schnitt für Öko-Betriebe schlechter<br />
ab <strong>als</strong> der Färsen-/Weideochsenverkauf.<br />
Für konventionelle Betriebe bringt<br />
der Verkauf von Färsen und männlichen<br />
Absetzern hingegen deutliche Vorteile<br />
gegenüber Färsen-/Weideochsenverkauf,<br />
schneidet aber dennoch schlechter ab <strong>als</strong><br />
der reine Absetzerverkauf. Nur wenig<br />
schlechter <strong>als</strong> die hessische Öko-Winterweide<br />
mit Färsen- und Weideochsenver.<br />
kauf stellt sich die bayerische Öko-<br />
Winterweide mit Baby-Beef-Verkauf<br />
dar (45 % geringere BR).<br />
Diese Vollkostenrechnungen zusammen<br />
mit der Simulation verschiedener<br />
Weideflächengrößen und Besatzdichten/<br />
-stärken haben klar ergeben, dass vor dem<br />
Hintergrund der jetzigen Subventions-<br />
und Fördermittelkulisse (ohne Einrechnung<br />
der Förderung durch das Grünlandprojekt)<br />
eine sehr wirtschaftliche<br />
Bewirtschaftung von großen Standweiden<br />
möglich ist. Erfolgsfaktoren waren dabei<br />
sehr deutlich die Großflächigkeit (durch<br />
geringere Zaunlängen und geringeren Arbeitsaufwand),<br />
die Winterfreilandhaltung<br />
(durch geringere Einstreukosten, bessere<br />
Fruchtbarkeits- und Aufzuchtleistungen,<br />
geringere oder keine Gebäudekosten),<br />
eine geringe Besatzdichte/-stärke auf der<br />
Weide (durch den Wegfall der Einzeltierprämien<br />
und höheren Flächenzahlungen)<br />
und die ökologische Betriebsweise.<br />
Für die Beratung von Weidegemeinschaften<br />
in der Gründungsphase und bessere<br />
Beratung von Einzellandwirten wurde ein<br />
Betriebsoptimierungs-Modul für Green<br />
X entwickelt. Hier sind nach der Berechnung<br />
konkret der Gesamtbetriebsgewinn<br />
und die geleisteten Arbeitsstunden des<br />
einzelnen Landwirts bzw. Weidegemeinschaftsmitglieds<br />
erkennbar. Eingegeben<br />
werden muss lediglich, was der Landwirt<br />
in das Produktionsverfahren einbringt<br />
(Weide, Heu- und Silageflächen, Vieh,<br />
Eigenkapital, Fremdkapital mit Verzinsung,<br />
Arbeitskraft). Das Programm<br />
ermittelt dann, was er von <strong>Dr</strong>itten (z.B.<br />
anderen Weidegemeinschaftsmitgliedern)<br />
ankaufen muss oder verkaufen<br />
kann. Anhand des Betriebsgewinns und<br />
der Jahresarbeitsstunden kann sich der<br />
Landwirt ein Bild über seine genaue<br />
betriebliche Situation machen und z.B.<br />
3 7