Antifa Hohenschönhausen - NEA
Antifa Hohenschönhausen - NEA
Antifa Hohenschönhausen - NEA
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
erhebliche Rolle. Nach 1934 wurde diese Strömung<br />
in Weißensee nicht mehr bekannt.<br />
Unter <strong>Antifa</strong>schismus war nicht irgendeine beliebige<br />
Gegenposition zu verstehen. Er beinhaltete immer<br />
das humanistische Anliegen, allen Schwächeren und<br />
Verfolgten zu helfen, ohne Ausnahmen, Einschränkungen<br />
und Bedingungen. Sein Kampf galt dem Unrecht<br />
insgesamt und nicht nur einzelnen Seiten oder<br />
Personen.<br />
Während des Krieges, von 1943 bis 1945, versteckte<br />
das sozialdemokratische Ehepaar Hedwig (1896-<br />
1978) und Otto Schrödter (1898-1971) in ihrem<br />
kleinen und beengten Einfamilienhaus in der <strong>Hohenschönhausen</strong>er<br />
Straße 156 Nr. 9 sechs jüdische Menschen,<br />
darunter ein zuerst sechs Monate altes Kind.<br />
1933 waren die Schrödters selbst vor dem SA-Terror<br />
aus Friedrichshain geflohen, wo die Eheleute als <strong>Antifa</strong>schisten<br />
bekannt waren, verfolgt und misshandelt<br />
wurden. Dort lebten sie in der Büschingstraße 30,<br />
zogen dann nach Prenzlauer Berg und 1934 schließlich<br />
nach <strong>Hohenschönhausen</strong> in ihr selbst erbautes<br />
bescheidenes Haus. Sie versorgten sie mit Lebensmitteln<br />
und bewahrten sie vor dem sicheren Tod. Der<br />
Widerstand der Schrödters zeigte, wie sinnvoll solche<br />
Einzelaktionen waren, denen scheinbar die Perspektive<br />
fehlte, denen aber die feste Überzeugung zugrundelag,<br />
dass die Unmenschlichkeit eines Tages besiegt<br />
wird. Der menschlich bewundernswerte Charakter<br />
der Schrödters äußerte sich in einer kompletten Ablehnung<br />
des faschistischen Alltags. Sie flaggten keine<br />
Nazi-Fahnen, ihren Sohn Herbert ließen sie nicht zur<br />
Hitlerjugend und Hedwig Schrödter wandte sich in<br />
Gesprächen offen gegen die Nazis, wofür sie viermal<br />
von der Gestapo vorgeladen wurde.<br />
Hedwig und Otto Schrödter<br />
Eine wahre Heldentat im illegalen antifaschistischen<br />
Kampf vollbrachte auch das Bäckerehepaar Elsa und<br />
Otto Hildebrandt, die Inhaber eines Ladens in der<br />
Quitzowstraße 51, heute Simon-Bolivar-Straße. Die<br />
Hildebrandts nahmen in den Jahren 1940 bis 1945 insgesamt<br />
dreizehn verfolgte Juden auf und versteckten<br />
sie im Keller der Bäckerei. Die Tat ist umso bewundernswerter,<br />
weil die Gegend eine Nazi-Ecke war.<br />
Umso mehr bewiesen die couragierten Bäckersleute,<br />
dass es überall in Berlin Möglichkeiten gab, den Bedrohten<br />
zu helfen. Der Arzt Dr. Heinz Ulrich Behrens<br />
aus <strong>Hohenschönhausen</strong>, Berliner Straße 1/2 war in<br />
diese Aktion eingeweiht.<br />
Ein beliebter und bekannter Arzt in den 1930er Jahren<br />
in <strong>Hohenschönhausen</strong> war Dr. Victor Aronstein. Seine<br />
Praxis befand sich in der Berliner Straße 126/Bahnhofstraße<br />
1 (seit 1985 Konrad-Wolf-Straße/Bahnhofstraße).<br />
Als Jude war er seit 1933 Verfolgungen und<br />
Demütigungen ausgesetzt. Sein breiter Patientenkreis<br />
aus verschiedenen sozialen Schichten sympathisierte<br />
mit ihm und unterstützte ihn. So wurde der Aufenthalt<br />
in seinem Wartezimmer zu einem Bekenntnis besonderer<br />
Art. Hier trafen sich politische Gegner der Nazis<br />
und organisierten Solidaritätssammlungen. 1941<br />
wurde Dr. Aronstein deportiert und kam in Auschwitz<br />
ums Leben.<br />
Es gilt auch, jener aufrechten Menschen zu gedenken,<br />
die im sicher geglaubten Hinterland aller <strong>Antifa</strong>schisten,<br />
in der Sowjetunion, ihr Leben lassen mussten.<br />
Stellvertretend für viele, die dem stalinistischen<br />
Terror der 1930er Jahre zum Opfer fielen, seien der<br />
Schuhmacher Johannes Pomierski, geboren 1903,<br />
Thaerstraße 6, Mitglied der KPD seit 1927, und der<br />
Koch Alfred Sorgatz, geboren 1891, Mitglied der<br />
KPD seit 1921, genannt. Beide Kommunisten waren<br />
Funktionäre des UB Berlin Nord-Ost. Sie emigrierten<br />
1933 bzw. 1934 in die Sowjetunion und wurden dort<br />
1937 und 1938 verhaftet und anschließend ermordet.<br />
Die stalinistischen Verbrechen können jedoch das<br />
Heldentum der Roten Armee bei der Befreiung vom<br />
Faschismus nicht relativieren, aber sie zeigen die Gefahr,<br />
die der Menschlichkeit, dem eigentlichen politischen<br />
Ziel des antifaschistischen Kampfes, selbst aus<br />
den eigenen Reihen drohen kann.<br />
Es fällt schwer, eine Bilanz des antifaschistischen<br />
Kampfes in Berlin-Nordost in seinen so vielfältigen<br />
Erscheinungsformen, den großen wie den kleinen, zu<br />
ziehen. Denn Widerstand wurde hier zu allen Zeiten<br />
und an allen Orten, in allen Straßen, und in allen sozialen,<br />
religiösen und politischen Gruppen geleistet.<br />
In Weißensee waren während der Jahre 1933 bis 1945<br />
schätzungsweise 2.700 Menschen in den Kampf gegen<br />
den Faschismus einbezogen, das waren 3,3 %<br />
seiner Bevölkerung. Die Ausstrahlung dieser Faschismusgegner<br />
auf weitere Sympathisanten und Freunde<br />
<strong>Antifa</strong>schistischer Widerstand in Berlin-Nordost /<br />
27



![Info-Broschüre zu Horst Wessel von der [AIWP]](https://img.yumpu.com/46050825/1/184x260/info-broschure-zu-horst-wessel-von-der-aiwp.jpg?quality=85)
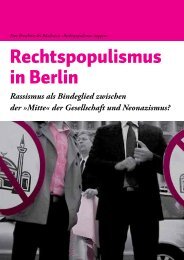

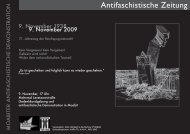

![Berliner anarchistisches Jahrbuch - North-East Antifascists [NEA]](https://img.yumpu.com/21345314/1/184x260/berliner-anarchistisches-jahrbuch-north-east-antifascists-nea.jpg?quality=85)