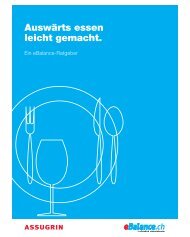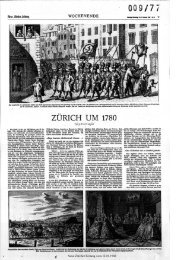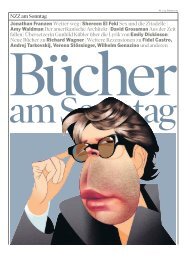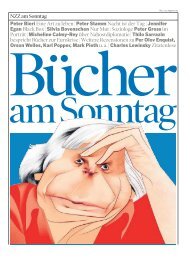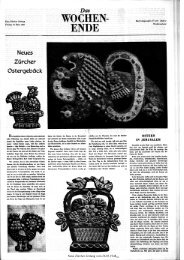Marcel Proust Hommage von Andreas Isenschmid |Sigmund Freud ...
Marcel Proust Hommage von Andreas Isenschmid |Sigmund Freud ...
Marcel Proust Hommage von Andreas Isenschmid |Sigmund Freud ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Essay<br />
1983 wurde <strong>Proust</strong>s Erzählung «Un amour de Swann» <strong>von</strong> Volker Schlöndorff verfilmt. Die Hauptrollen spielten<br />
Jeremy Irons und Fanny Ardant (beide im Vordergrund).<br />
rue Laurent-Pichat beklagte? «Die Nachbarn<br />
treiben jeden Tag Liebe mit einer Raserei, die<br />
mich eifersüchtig macht. Wenn ich daran denke,<br />
dass diese Empfindung für mich noch schwächer<br />
ist als die, ein Glas kühles Bier zu trinken,<br />
beneide ich die Leute, die solche Schreie ausstossen,<br />
dass ich beim ersten Mal an einen Mord<br />
dachte, doch der Schrei der Frau, eine Oktave<br />
tiefer vom Mann wiederholt, hat mir über das<br />
Geschehen bald Gewissheit verschafft.» Und<br />
gab es nach dieser Passage in der Briefausgabe<br />
nicht merkwürdige Auslassungen in eckigen<br />
Klammern? Was da wohl noch gekommen wäre?<br />
Wenn der <strong>Proust</strong>ianer auf seiner Lustreise<br />
durch Tadiés Wälzer auf Seite 821 angekommen<br />
ist, löst sich das Rätsel – Tadié liefert die Textlücken<br />
nach. Er hat sich, wo, sagt er nicht, das<br />
Brieforiginal angesehen, das der Herausgeber<br />
der Korrespondenz noch nach einem unvollständigen<br />
Auktionskatalog zitiert hatte, und er<br />
hat einen bemerkenswerten Fund getan. «Der<br />
letzte Schrei ist noch nicht ganz ausgestossen»,<br />
heisst es in den ausgelassenen Sätzen, «da stürzen<br />
sie sich auf ein Sitzbad und der Krach endet<br />
mit einem Geräusch fliessenden Wassers.»<br />
Neue Facetten blitzen auf<br />
So weit so gut; das hatte auch schon Keller in<br />
seinem Kommentar zur «Recherche» nachgetragen.<br />
Doch dann wartet <strong>Proust</strong> mit einem<br />
Geständnis auf, dessen Unverblümtheit bei<br />
einem, der seine Homosexualität immer ebenso<br />
kunstvoll lebte wie verbarg, mehr als erstaunt.<br />
«Das völlige Fehlen eines Übergangs strengt<br />
mich an ihrer Stelle an, denn wenn es etwas<br />
gibt, das ich danach verabscheue, oder zumindest<br />
sofort danach, dann ist es, sich zu bewegen.<br />
Welcher Egoismus auch darin enthalten<br />
sein mag, die milde Wärme eines Mundes, der<br />
nichts mehr aufzunehmen hat, an derselben<br />
Stelle festzuhalten.»<br />
Das ist auch für die, die <strong>Proust</strong>s ebenso masochistische<br />
wie witzige Bordellszenen gelesen<br />
haben, eine nette Facette im Bild ihres <strong>von</strong> manchen<br />
für einen reinen Ästheten gehaltenen<br />
Autors. Was hätte man darum gegeben, Ähn-<br />
14 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 31. Januar 2010<br />
liches einmal in einem der feinsinnigen Bücher<br />
über den halbseidenen Stefan George zu lesen?<br />
Aber Tadié bringt diese Passage nicht um der<br />
knisternden Anekdote willen. Er erwähnt sie,<br />
weil sie für die überzeugende Methode seiner<br />
Biografie notwendig ist. Für Tadié ist die<br />
«eigentliche Biografie eines Schriftstellers»<br />
nicht spekulatives Stochern in der Vita des<br />
Künstlers, sondern die wohlbegründete «Biografie<br />
seines Werkes». Also zeigt er, wie <strong>Proust</strong><br />
seine Briefbemerkungen vom Juli 1919 fast<br />
Die Biografie sammelt die<br />
scheinbar unbedeutendsten<br />
Mosaiksteinchen und fügt<br />
sie zur Geschichte der<br />
Entstehung der berühmten<br />
«Recherche».<br />
wortwörtlich flugs in die Druckvorlage des<br />
Romanbandes «Sodom und Gomorrha» einfügte,<br />
in dessen Manuskript sie noch nicht standen.<br />
Und wie er in der 2.Auflage des Bandes mit<br />
handschriftlichen Randnotizen nochmals am<br />
Wortlaut der Stelle herumfeilte.<br />
Das ist das Wunder <strong>von</strong> Tadiés Biografie:<br />
Sie sammelt akribisch noch die scheinbar<br />
unbedeutendsten Mosaiksteinchen und fügt sie<br />
geduldig zur Entstehungsgeschichte der<br />
«Recherche» zusammen. Welche Einflüsse<br />
formten das so überwältigende Erkenntnisinstrument,<br />
als das uns <strong>Proust</strong>s Stil erscheint?<br />
Wie baute er seine so plastischen und so<br />
abgründigen Figuren auf, etwa den schwulen<br />
Baron Charlus, eine Figur, die auch Shakespeare<br />
wohl angestanden hätte? Tadié zeigt mit einem<br />
immensen Reichtum an Fakten, welch unglaubliches<br />
Quantum an Erfahrungen aller Art <strong>Proust</strong><br />
in sich aufnahm, um es in seinen Romankosmos<br />
umzuformen. Die Lektüre dieses Riesenwerkes<br />
gleicht freilich einer Winterwanderung in tie-<br />
pwe<br />
fem nassem Schnee, immer wieder sinkt man<br />
ein, oft verliert man den Weg. Erzählen kann<br />
Tadié wirklich nicht. Seine Biografie ist der Fall<br />
eines streckenweise fast unlesbaren, aber hundertprozentig<br />
unentbehrlichen Buches. Man<br />
ärgert sich nicht selten grün und blau – und<br />
wird zum Nachlesen doch stets zu diesem Standardwerk<br />
zurückkehren.<br />
Wie anders wird es dem <strong>Proust</strong>ianer, wenn<br />
er sich der vom Zürcher Romanistikprofessor<br />
und <strong>Proust</strong>forscher Luzius Keller herausgegebenen<br />
«<strong>Marcel</strong> <strong>Proust</strong> Enzyklopädie» zuwendet.<br />
Durch dieses Buch summt er wie eine Biene<br />
durch das Blütenmeer einer sonnenwarmen<br />
blühenden Alpenwiese. Was immer er während<br />
seiner <strong>Proust</strong>-Lektüre genauer wissen möchte<br />
– Keller weiss es. Ihn frappiert der Konversationsstil<br />
in <strong>Proust</strong>s Salonszenen? Kellers Konversationsartikel<br />
klärt ihn zuverlässig auf. Er<br />
fragt sich, was es mit den Monokeln auf sich<br />
hat, mit denen die Salonlöwen so wichtigtun?<br />
In der «Enzyklopädie» steht es. Was es mit den<br />
Figuren auf sich hat, die sich in den Salons tummeln,<br />
wer ihre Vorbilder sind – Keller fragen.<br />
Enzyklopädisches Wissen<br />
Das Nachschlagen summiert sich mit der Zeit<br />
zu einer überraschungsreichen Reise durch die<br />
Kulturgeschichte Frankreichs. Fast jeder Eintrag<br />
«vaut un détour», michelinisch gesprochen.<br />
Wir erfahren nicht nur, wie sich in <strong>Proust</strong>s<br />
Umgang mit Racines jüdischer Dramenheldin<br />
Esther sein Verhältnis zu seinem eigenen Judentum<br />
verpuppte. Wir werden <strong>von</strong> Keller auch auf<br />
einen ganz eigenen Lektüre- und Suchparcours<br />
gewiesen. Im Konversationsartikel lesen wir:<br />
«Wir sprechen für die anderen. Doch wir<br />
schweigen für uns selbst. Deshalb trägt das<br />
Schweigen, im Gegensatz zum Sprechen, nicht<br />
die Spur unserer Fehler und unserer Grimassen.<br />
Es ist rein.»<br />
Wie konnte man diese Sätze aus «Tage des<br />
Lesens» vergessen; man geht hin und liest nach.<br />
Und nicht selten legt man die «Enzyklopädie»<br />
mit lautem Lachen aus der Hand. Wer wusste<br />
schon, «dass <strong>Proust</strong> bis um 1900 prou ausgesprochen<br />
wurde, dass mit dem gleichlautenden<br />
‹prout› das Geräusch eines Furzes bezeichnet<br />
wird und dass ‹prout› als Interjektion Schwulheit<br />
evoziert»?<br />
In der französischen Originalausgabe der<br />
«Enzyklopädie» sucht man die feinsten Einsichten<br />
der deutschen indes vergeblich. Keller<br />
hat das <strong>von</strong> den besten <strong>Proust</strong>forschern verfasste<br />
Kollektivwerk für die deutsche Ausgabe<br />
<strong>von</strong> recht vielen schwachen Artikeln befreit<br />
und zahllose neue eigene beigesteuert. Das ist<br />
Kellers Stil: Diskret liefert er sein Hauptwerk in<br />
Gestalt eines fast anonym daherkommenden<br />
Sammelwerkes ab, in dem, wenn man genauer<br />
hinsieht, zufällig einfach ein paar hundert Seiten<br />
<strong>von</strong> ihm verfasst sind. Sein zweites Hauptwerk<br />
übrigens; das erste waren die 14 Bände der<br />
Frankfurter <strong>Proust</strong>-Ausgabe, die er herausgegeben,<br />
kommentiert und übersetzerisch revidiert<br />
hat – gibt es für so was eigentlich keine<br />
Literaturpreise?<br />
Was tut der <strong>Proust</strong>ianer, wenn er lesensmüde<br />
wird? Er reist im Mai nach Illiers, das <strong>Proust</strong> als<br />
Combray verewigt hat, schnuppert durchs Haus<br />
der <strong>Proust</strong>s, bummelt der Vi<strong>von</strong>ne entlang, die<br />
in Wirklichkeit Loir heisst, bewundert den Flieder<br />
und reist weiter ins <strong>Proust</strong>sche Seebad<br />
Balbec, das in Wirklichkeit Cabourg heisst,<br />
mietet sich im Grand-Hotel ein und sieht aufs<br />
Meer. Wenn ihn die tröstliche Einsicht überkommt,<br />
dass <strong>Proust</strong> das alles viel schöner<br />
beschrieben hat, als es ist, dass die Literatur<br />
also dem (Reise-)Leben vorzuziehen sei, reist<br />
er heim und macht weiter wie immer. Man<br />
muss sich den <strong>Proust</strong>ianer eben als einen glücklichen<br />
Menschen vorstellen. ●