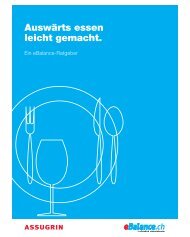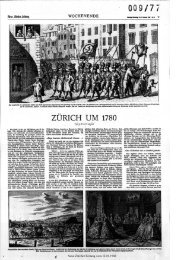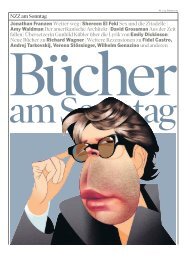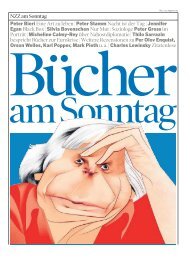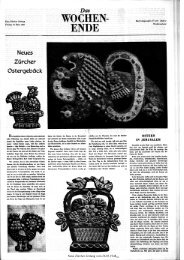Marcel Proust Hommage von Andreas Isenschmid |Sigmund Freud ...
Marcel Proust Hommage von Andreas Isenschmid |Sigmund Freud ...
Marcel Proust Hommage von Andreas Isenschmid |Sigmund Freud ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Roman Der jungedeutsche AutorKristof Magnusson<br />
lässt drei Menschen da<strong>von</strong>erzählen, wie sie in eine<br />
Sackgasse geratensind<br />
Wenn dasLeben<br />
aufder Kippesteht<br />
KristofMagnusson: Daswar ich nicht.<br />
Antje Kunstmann, München 2010.<br />
288 Seiten, Fr.33.90.<br />
Von Simone <strong>von</strong> Büren<br />
Einer der Protagonisten im zweiten<br />
Roman <strong>von</strong> Kristof Magnusson tritt<br />
eines Abends auf seinen Balkon im 38.<br />
Stockwerk eines Chicagoer Hochhauses,<br />
barfuss und im T-Shirt bei minus 18 Grad<br />
Celsius. Ein Windstoss schlägt die Balkontür<br />
zu, und er befürchtet, sich soeben<br />
ausgesperrt zu haben und bei den schallisolierten<br />
Fenstern und dem dichten<br />
Verkehr <strong>von</strong> keiner Menschenseele<br />
gehört zu werden. So wenig braucht es,<br />
um in der Kälte zu stehen. In «Das war<br />
ich nicht» spielt Magnusson augenzwinkernd<br />
durch, was uns die aktuelle Wirtschaftskrise<br />
bitterernst gezeigt hat: wie<br />
schnell sich der American Dream im<br />
kapitalistischen System in sein Gegenteil<br />
verkehren und Millionäre zu Tellerwäschern<br />
machen kann.<br />
Magnusson, dessen Début «Zuhause»<br />
2006 mit dem Rauriser Literaturpreis<br />
ausgezeichnet wurde, lässt in seinem<br />
neuen Roman abwechselnd drei einsame<br />
Ich-Erzähler zu Wort kommen, die mit<br />
ihren bisherigen Lebensentwürfen in<br />
eine Sackgasse geraten sind. Jasper, ein<br />
junger deutscher Trader, setzt bei einer<br />
Bank in Chicago alles auf die Karte Karriere<br />
und geht «wie ferngesteuert»<br />
durchs Leben. Er opfert sich auf für ein<br />
Unternehmen, in dem sein Name «in<br />
eine Plastikhalterung geschoben und<br />
jederzeit austauschbar» ist. Die literarische<br />
Übersetzerin Meike trennt sich<br />
überstürzt <strong>von</strong> ihrem langjährigen Partner<br />
und vom gemeinsamen Kinder kriegenden<br />
und Ökoprodukte kaufenden<br />
Freundeskreis in Hamburg und zieht in<br />
ein baufälliges Haus auf dem Land. Und<br />
der sechzigjährige amerikanische Autor<br />
Henry LaMarck taucht unter, weil er seinen<br />
Jahrhundertroman über 9/11, der<br />
schon vor seinem Erscheinen für den<br />
Pulitzerpreis nominiert worden ist,<br />
nicht schreiben kann.<br />
Der 33-jährige Autor und Übersetzer<br />
aus dem Isländischen lässt seine drei<br />
Erzähler auf faszinierende Weise miteinander<br />
ins Geschäft kommen und einander<br />
abwechselnd zur «letzten Chance»<br />
werden in einer zunehmend dramatischen<br />
Geschichte, in der Geld eine<br />
wesentliche Rolle spielt: fehlendes,<br />
übermässiges und vor allem virtuelles.<br />
Auf packende Weise vermittelt Magnusson<br />
den Sog, der in den Finanz-Arenen<br />
entsteht und das Betrügen mit steigenden<br />
Beträgen abstrakter und einfacher<br />
werden lässt.<br />
Der auch als Dramatiker erfolgreiche<br />
Autor erweist sich erneut als sorgfältiger<br />
Architekt narrativer Zusammenhänge,<br />
forciert allerdings einige Stränge –<br />
etwa Henrys Bekanntschaft mit Elton<br />
John. Stellenweise schwächt er ausser-<br />
Kristof Magnusson<br />
beschreibt einsame<br />
Menschen in der<br />
Grossstadt, so einen<br />
deutschen Banker in<br />
Chicago.<br />
Roman Eine unaufgeregte<strong>Hommage</strong>andie tschechische Sportlegende Emil Zátopek<br />
Titander Leichtathletik<br />
Jean Echenoz: Laufen.<br />
Ausdem Französischen <strong>von</strong>Hinrich<br />
Schmidt-Henkel. Berlin-Verlag,<br />
Berlin 2009. 126 Seiten, Fr.31.50.<br />
Von Sandra Leis<br />
Persönlichkeiten <strong>von</strong> Weltruhm elektrisieren<br />
ihn: In «Die grossen Blondinen»<br />
(2002) sind es Marlene Dietrich, Marilyn<br />
Monroe und Brigitte Bardot, in «Ravel»<br />
(2007) ist es Maurice Ravel. Jetzt setzt er<br />
in «Laufen» dem tschechischen Langstreckenläufer<br />
Emil Zátopek ein Denkmal.<br />
Sport, so gibt Jean Echenoz, der 62jährige<br />
französische Meister des dosierten<br />
Spannungsbogens, zu Protokoll, habe<br />
ihn zeitlebens nie interessiert. Trotzdem<br />
hat er sich festgebissen an Zátopek, zu<br />
dessen spektakulärsten Leistungen der<br />
dreifache Olympiasieg 1952 in Helsinki<br />
gehört: Innerhalb weniger Tage gewann<br />
er über 5000 und 10 000 Meter sowie im<br />
Marathon die Goldmedaille.<br />
Echenoz durchforstete mehrere tausendNummernderZeitschrift«L’Equipe»<br />
der Jahrgänge 1946 bis 1957 und schrieb<br />
dann einen kleinen hübschen Roman<br />
über diesen Volkshelden und tschechischen<br />
Exportschlager im Kalten Krieg,<br />
der stets «ein gewissenhafter Junge» war,<br />
naiv und politisch unbedarft. Emil ist 17<br />
Jahre alt, aus dem Sportmuffel wird einer,<br />
der fanatisch bis über die Schmerzgrenze<br />
hinaus trainiert und die Emil-Methode<br />
perfektioniert. Sein Stil ist alles andere<br />
als elegant, aber legendär: Er kämpft sich<br />
voran, «schwer, zerquält, gemartert,<br />
ruckartig. Er verhehlt nicht, wie grausam<br />
er sich müht.» «Die tschechische Lokomotive»,<br />
so lautet sein Spitzname.<br />
Während Echenoz in «Ravel» Stationen<br />
des Künstlerlebens detailreich und<br />
höchst einfühlsam zu Papier brachte,<br />
nimmt er sich in «Laufen» sehr zurück.<br />
dem seine Erzähler, wenn er in erklärenden<br />
Ausführungen zu Facebook oder<br />
zum Chicagoer Valentinstag-Massaker<br />
als pflichtbewusster Autor zu dominant<br />
wird oder vereinzelt Vergleiche und<br />
Metaphern überfrachtet. So beschreibt<br />
er die Frisur einer Verlegerin wirkungsvoll<br />
als «einbetoniertes Baiser» und<br />
malt dann aus, «wie sie in ihrem schwarzen<br />
Mercedes-Cabriolet den Lake Shore<br />
Drive entlangbrauste und kein einziges<br />
Haar auch nur ins Zittern kam». Oder er<br />
lässt Meike die Klappe eines amerikanischen<br />
Briefkastens öffnen, «vorsichtig<br />
wie die Tür eines Backofens, nachdem<br />
die Schaltuhr geklingelt hatte und die<br />
Tiefkühllasagne nach fünfzig Minuten<br />
endlich fertig war».<br />
Die Moral <strong>von</strong> der Geschicht: Drei<br />
Menschen wollen sich mit Karriere,<br />
Ruhm und aussergewöhnlichen Lebensentwürfen<br />
profilieren, geraten aus dem<br />
Konzept, verlieren Geld, ruinieren ihren<br />
Ruf und werden weit weg <strong>von</strong> den Forderungen<br />
der Leistungsgesellschaft mit<br />
ganz wenig glücklich.<br />
Das mag ein wenig banal sein, gegen<br />
Schluss auch klischiert, aber es zeigt mit<br />
Humor und Schwung, wie sich individuelle<br />
Lebensentwürfe und gesellschaftliche<br />
Systeme erschöpfen und nach<br />
einer Krise neu entwickeln können. In<br />
diesem Sinn macht der Text eine Aussage<br />
zu unserer Zeit weit über die vielen<br />
konkreten Verortungen hinaus, die er<br />
vornimmt. ●<br />
Wir erfahren nicht, was Zátopek denkt<br />
oder fühlt, Echenoz fokussiert auf die<br />
Wettkämpfe – im Stil des Slapsticks,<br />
lakonisch und komisch, doch nie verräterisch.<br />
Sein Held liegt ihm am Herzen,<br />
und als Emil «in kurzer Hose und ausgewaschener<br />
Trainingsjacke» nach dem<br />
Zweiten Weltkrieg als 24-Jähriger in<br />
Berlin die Weltbühne erobert, recken<br />
auch wir die Faust zum Triumph.<br />
Zwei historische Daten prägen das<br />
Leben <strong>von</strong> Zátopek: die Besetzung seiner<br />
Heimat 1939 durch die Deutschen<br />
und der Prager Frühling 1968, dem der<br />
Einmarsch der Russen ein brutales Ende<br />
setzt. Emil Zátopek, der «aufrichtig an<br />
die Tugenden des Sozialismus glaubt»,<br />
kämpft für eine freiheitliche Tschechoslowakei.<br />
Die Folgen sind fatal, Echenoz<br />
hakt sie auf dreieinhalb Seiten ab und<br />
verabschiedet seinen Helden mit dem<br />
Satz: «Ich habe es gewiss nicht anders<br />
verdient.» ●<br />
31. Januar 2010 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 7<br />
Brian MurphY / aLaMY