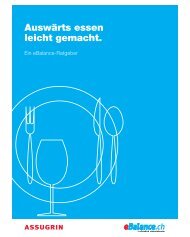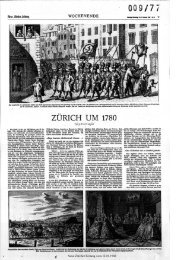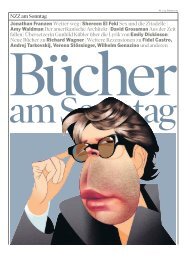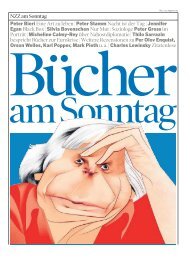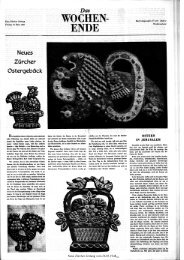Marcel Proust Hommage von Andreas Isenschmid |Sigmund Freud ...
Marcel Proust Hommage von Andreas Isenschmid |Sigmund Freud ...
Marcel Proust Hommage von Andreas Isenschmid |Sigmund Freud ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
BiLd archiv<br />
Religion UrsAltermatt schreibt über die langwierigeAnpassung des Katholizismus in der Schweiz<br />
Wieeinereligiöse Minderheit<br />
sich erfolgreichintegrierte<br />
UrsAltermatt:Konfession, Nation und<br />
Rom. Metamorphosen im<br />
schweizerischen und europäischen<br />
Katholizismus des 19. und 20.Jahrhunderts.<br />
Huber,Frauenfeld 2009.<br />
442 Seiten, Fr.58.–.<br />
Von Klara Obermüller<br />
Die Zeit ist noch gar nicht allzu fern, da<br />
galten Katholiken in der Schweiz als<br />
unzuverlässige Patrioten. Sie bildeten<br />
Sondergesellschaften, sahen sich dem<br />
Verdacht der «doppelten Loyalität» ausgesetzt<br />
und taten sich schwer sowohl<br />
mit den Errungenschaften der Moderne<br />
wie auch mit den Gepflogenheiten der<br />
Demokratie. Mehr als 100 Jahre, <strong>von</strong><br />
1848 bis weit über den Zweiten Weltkrieg<br />
hinaus, sollte der Integrationsprozess<br />
des politischen Katholizismus in<br />
Feminisierung der Arbeitswelt Stolz auf ihren Beruf<br />
201 Mal hatder Fotograf Josef Riegger abgedrückt.<br />
201 Mal steht da eine Frau, vordem gleichen, etwas<br />
irritierenden Hintergrund, in gleicher Pose und dennoch<br />
eigenständig, individuell ausgestattetmit den<br />
selbstgewählten Insignien ihres Berufes. Die Frauen<br />
blicken ernstindie Kamera, lächeln oder lachen, sind<br />
selbstsicher,keck, verschmitzt, frech und manchmal<br />
auch ein wenig verlegen. Aber immer unübersehbar<br />
stolz auf ihren Beruf,ihreTätigkeit, ihr Wissen und<br />
Können. Vonder Archäologin über die Berufsfeuerwehrfrau<br />
(Bild links), die Lokführerin, die Neurochirurgin<br />
(rechts)bis zurZimmerin sind unzählige<br />
Berufsgattungen vertreten. Ja, wir Frauen in der<br />
Schweiz haben es weit gebracht, könnteman meinen.<br />
Wirsind jetzt –fast–überall dabei. Die kurzen Zwischentexte<br />
oder Zwischentöne der Politologin Regula<br />
den schweizerischen Bundesstaat dauern.<br />
Zu einem endgültigen Abschluss<br />
gelangte er im Grunde erst im Jahr 1973,<br />
als mit dem Jesuiten- und dem Klosterartikel<br />
auch noch die letzte Ausnahmeregelung<br />
aus der Bundesverfassung<br />
gestrichen wurde.<br />
Stationen zum Bundesstaat<br />
In Zeiten, da wieder einmal heftig über<br />
die Stellung religiöser Minderheiten in<br />
unserem Land gestritten wird, kann es<br />
ausgesprochen nützlich sein, sich dieser<br />
langwierigen Anpassungsgeschichte<br />
des schweizerischen Katholizismus<br />
und seiner europäischen Parallelen zu<br />
erinnern.<br />
20 Jahre nach seinem Werk über<br />
«Katholizismus und Moderne» legt der<br />
Freiburger Historiker Urs Altermatt ein<br />
weiteres Mal Grundlagen zu solcher<br />
Rückbesinnung vor. In seinem umfang-<br />
Staempfli, gewohnt provokativ und ungeschminkt,<br />
holen einen dann wieder auf den Boden der Realität,<br />
wenn sie laut in Erinnerung ruft, dass bei der Feminisierung<br />
eines Berufes sofort Ansehen und Lohn sinken.<br />
Dass Frauenforschung systematisch nicht zitiert<br />
wird. Dass die Welt voller Gynäkologenist,aber kaum<br />
Urologinnen praktizieren. Dass noch immer Männer<br />
Frauen kaufen dürfen. Dass noch immer erschreckend<br />
wenigeProfessorinnen lehren und die Chefredaktorengrosser<br />
Politmedien stets Männer sind. Warum<br />
aber für die Realisierung dieser tollen Idee nicht eine<br />
Fotografin zumZug gekommen ist, das wissen die<br />
Göttinnen. GenevièveLüscher<br />
Josef Riegger (Fotos), Regula Staempfli(Text):<br />
Frauen ohne Maske. Stämpfli, Bern 2009.<br />
201 Fotografien, 304 Seiten, Fr.49.–.<br />
reichen neuen Buch mit dem auf den<br />
ersten Blick etwas irritierenden Titel<br />
«Konfession, Nation und Rom» zeichnet<br />
er die Stationen nach, die aus den einstigen<br />
Verlierern des Sonderbundskrieges<br />
vollwertige Bürger des schweizerischen<br />
Bundesstaates gemacht haben. Der politisch-kulturelle<br />
Assimilationsprozess an<br />
die national-liberal und protestantisch<br />
geprägte Leitkultur des Landes ist dabei<br />
ebenso ein Thema wie der innerkirchliche<br />
Wandel, der diese Anpassung und<br />
die damit verbundene Emanzipation<br />
erst möglich gemacht hat. Dass sich im<br />
Zuge dieser Entwicklung allerdings auch<br />
das vormals blühende katholische Milieu<br />
mit all seinen Vereinen, Verbänden,<br />
Institutionen und eigenen Presseerzeugnissen<br />
auflöste, ist gewissermassen der<br />
Preis, den der Schweizer Katholizismus<br />
für die erfolgreiche Integration zu<br />
bezahlen hatte.<br />
Urs Altermatt selbst gehört einer<br />
Generation an, die diese Veränderungen<br />
selbst noch hautnah miterlebt hat. Als<br />
Katholik ist er in die Geschichte unmittelbar<br />
involviert und kann vielfach auch<br />
aus der eigenen Erfahrung schöpfen.<br />
Diese persönliche Note tut seiner über<br />
weite Strecken arg trockenen und langatmigen<br />
Wissenschaftsprosa ausgesprochen<br />
gut, und man hätte sich im Interesse<br />
der Lesbarkeit des Textes auch für<br />
interessierte Laien gewünscht, dass die<br />
historischen Kapitel etwas weniger ausführlich<br />
ausgefallen und die Bezüge zur<br />
Gegenwart dafür noch etwas deutlicher<br />
herausgearbeitet worden wären.<br />
Europäisches Fallbeispiel<br />
Der Einwand gilt nicht für den höchst<br />
aufschlussreichen und äusserst konzisen<br />
Schluss-Essay mit dem programmatischen<br />
Titel «Vom Konfessionalismus<br />
zur universalen Religion». In dieser religionssoziologischen<br />
Studie macht Altermatt<br />
einmal mehr deutlich, dass er die<br />
wechselvolle Geschichte des Schweizer<br />
Katholizismus keineswegs isoliert betrachtet,<br />
sondern sie als ein europäisches<br />
Fallbeispiel verstanden wissen<br />
will, an dem sich die parallel verlaufenden<br />
Erosionsprozesse sowohl der Nationen<br />
wie auch der Grosskirchen aufzeigen<br />
lassen. Interessant ist dabei zu<br />
sehen, wie die Bestrebungen des Zweiten<br />
Vatikanums und die sozialen Aufbruchbewegungen<br />
der sogenannten<br />
«langen sechziger Jahre» in die gleiche<br />
Richtung zielten und so ein Klima entstehen<br />
liessen, in dem der Dialog an die<br />
Stelle der einstmals identitätsstiftenden<br />
Abschottung treten konnte.<br />
Ohne explizit darauf zu verweisen,<br />
liefert Altermatts differenzierte Studie<br />
damit Hinweise, die inskünftig auch für<br />
die Integrationsbemühungen anderer<br />
religiöser Minderheiten <strong>von</strong> Bedeutung<br />
sein könnten. ●<br />
31. Januar 2010 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 23