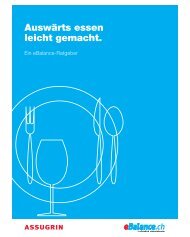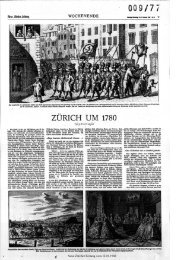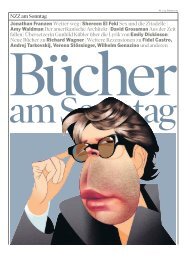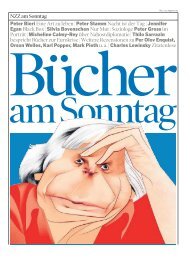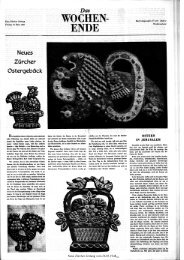Marcel Proust Hommage von Andreas Isenschmid |Sigmund Freud ...
Marcel Proust Hommage von Andreas Isenschmid |Sigmund Freud ...
Marcel Proust Hommage von Andreas Isenschmid |Sigmund Freud ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Musik Zwei unterschiedliche Monografien widmen sich den beiden Rebellen<br />
der modernen Oper: Nikolaus Harnoncourt und Hans Werner Henze<br />
Grossmeisterder Klangwelt<br />
Johanna Fürstauer,Anna Mika: Oper<br />
sinnlich. Die Opernwelten des Nikolaus<br />
Harnoncourt. Residenz, St.Pölten 2009.<br />
400Seiten, Fr.49.50.<br />
Jens Rosteck: Hans Werner Henze.<br />
Rosen und Revolutionen. Propyläen,<br />
Berlin 2009. 576 Seiten, Fr.47.50.<br />
Von Corinne Holtz<br />
Sie gelten als Grossmeister und schreiben<br />
seit einem halben Jahrhundert<br />
Musik- und Zeitgeschichte: Nikolaus<br />
Harnoncourt, Dirigent und Musikforscher<br />
aus Graz, ist die zentrale Figur der<br />
Erneuerung der Aufführungspraxis nach<br />
1950; Hans Werner Henze, Komponist<br />
und Essayist aus Gütersloh, ist als Poet<br />
allein unter den Avantgardisten und<br />
steht seit 1957 unter dem Generalverdacht<br />
des Schöntöners. Die beiden<br />
trennt mehr als das, was sie generationsmässig<br />
verbindet, und doch eröffnen<br />
sich beim Lesen der zwei völlig unterschiedlich<br />
angelegten Bücher Gemeinsamkeiten:<br />
Beide blicken auf ein rebellisch<br />
verteidigtes Lebenswerk zurück,<br />
das polarisiert, und beide sind Publikumsmagneten,<br />
die nach wie vor für<br />
Gesprächsstoff sorgen.<br />
Die Oper: neu interpretiert<br />
Die Publizistinnen Johanna Fürstauer<br />
und Anna Mika greifen ein Thema kaum<br />
aufgearbeiteterInterpretationsgeschichte<br />
auf, indem sie Harnoncourts Erneuerung<br />
der Operninterpretation zum<br />
Thema machen. Dabei lassen sie in<br />
«Oper sinnlich» vor allem Dritte sprechen:<br />
Entlang den <strong>von</strong> Harnoncourt aufgeführten<br />
Opern <strong>von</strong> Monteverdi über<br />
Mozart bis Gershwin zitieren die Autorinnen<br />
Musiker, Sängerinnen, Intendanten<br />
und Journalisten, verzichten<br />
auf eigene Einordnungen, vermitteln<br />
aber musikhistorische Hintergründe der<br />
Werke. Der Monteverdi-Zyklus am<br />
Opernhaus Zürich etwa wird <strong>von</strong> aufgeschlossenen<br />
Musikern kommentiert, die<br />
dabei waren, als andere noch den Misserfolg<br />
fürchteten. Der Fagottist Erich<br />
Zimmermann berichtet <strong>von</strong> den Berührungsängsten<br />
der Orchestermusiker und<br />
erinnert sich an die Rekrutierung für<br />
Harnoncourts Pionierprojekt in der Zeit<br />
vor 1975. Wer ist bereit, ein sogenanntes<br />
Originalinstrument zur Hand zu nehmen<br />
und sich spieltechnisch damit vertraut<br />
zu machen? «Mein Name war ein<br />
halbes Jahr lang der einzige auf der Liste.<br />
Kollegen haben mich gefragt: Willst du<br />
wirklich Teil eines Misserfolgs werden?<br />
Stattdessen wurde ich Teil eines Riesenerfolgs!»<br />
Harnoncourt selbst, der mit «Ulisse»<br />
und «Poppea» <strong>von</strong> 2002 und 2005 ein<br />
weiteres Mal auf Monteverdi zurückgekommen<br />
ist, würdigt seine Mitstreiter<br />
<strong>von</strong> damals und spricht <strong>von</strong> den hochmotivierten<br />
«Freiwilligen», die ihre<br />
Nikolaus Harnoncourt<br />
dirigiert in Wien das<br />
Neujahrskonzert<br />
2001 der Wiener<br />
Philharmoniker.<br />
«Freizeit geopfert» haben. Zwischen<br />
den Zeilen erfährt die Leserin, dass das<br />
spieltechnische Niveau <strong>von</strong> damals aus<br />
nachvollziehbaren Gründen schlechter<br />
war als heute, was Harnoncourt jedoch<br />
als «unfair» zu sagen betrachtet. Diese<br />
Darstellungsweise durchzieht das Buch,<br />
in dem verschiedene Textsorten (Essay,<br />
Reportage, Quellentext) aneinandergereiht<br />
sind – das ist einerseits abwechslungsreich,<br />
anderseits vermisst man eine<br />
Handschrift und kritische Fragestellungen.<br />
Dass Harnoncourt nur ausserhalb<br />
etablierter Institutionen sich selbst bleiben<br />
konnte und was hinter der erbitterten<br />
Gegnerschaft <strong>von</strong> Harnoncourts<br />
Ästhetik steckt – solche Beobachtungen<br />
sucht man vergebens. Hingegen werden<br />
Seitenhiebe auf das «Regietheater» ausgeteilt,<br />
dessen ungenannte Regisseure<br />
sich angeblich über die Musik erheben.<br />
Spannend wird es immer dann, wenn<br />
Harnoncourt selbst spricht – etwa im<br />
Plädoyer für Mozarts 1980 noch unterschätzten<br />
«Idomeneo» – oder schreibt.<br />
Ganz anders geht der Musik- und<br />
Literaturwissenschafter Jens Rosteck<br />
vor, der die erste grosse Biografie über<br />
Hans Werner Henze verfasst hat. Er feiert<br />
den zu «Jähzorn» und «ausgewachsenen<br />
Tobsuchtsanfällen» neigenden<br />
Knaben Hans als die «massstabsetzende»<br />
linke Persönlichkeit der Bundesrepublik<br />
Deutschland, der als «Tonschöpfer»<br />
mindestens «ebenso bedeutend»<br />
sei «wie seine inzwischen verstorbenen<br />
Generationsgefährten Karlheinz Stockhausen<br />
und Mauricio Kagel». Rosteck<br />
spricht vom ewigen «Rebell der zweiten<br />
Jahrhunderthälfte» und spart nicht mit<br />
Lob für den Aussenseiter, der sich künstlerisch<br />
und persönlich stets exponiert<br />
und Ausgrenzung nicht allein als bekennender<br />
Homosexueller erfahren hat. Die<br />
Wurzeln dieser Verletzung vermutet die<br />
Leserin im Verrat durch den Vater, der<br />
sich vom linksliberalen Volksschullehrer<br />
zum überzeugten Nationalsozialisten<br />
wandelte.<br />
Ins Gespräch gebracht<br />
Die Schilderung dieser traumatisierenden<br />
Kindheit gehört zu den stärksten<br />
Passagen der Biografie, die sich stellenweise<br />
wie ein Thriller liest und vom Erzähltalent<br />
des sprachmächtigen Autors<br />
zeugt. Die Musik Henzes allerdings<br />
kommt zu kurz, deren Darstellung<br />
beschränkt sich weitgehend auf Werktitel<br />
und auf Skandale wie jenen an den<br />
Donaueschinger Musiktagen 1957, als<br />
Boulez, Nono und Stockhausen den Saal<br />
verlassen, während Henzes «Nachtstücke<br />
und Arien» auf Gedichte <strong>von</strong> Ingeborg<br />
Bachmann erklingen. Der Herausforderung,<br />
die musikalische Ästhetik<br />
Henzes und deren Position in der<br />
Moderne nachvollziehbar zu beschreiben,<br />
hat sich der Autor nicht gestellt.<br />
Hingegen hat er die Fülle <strong>von</strong> Quellenmaterial<br />
zu nutzen gewusst und akribische<br />
Genauigkeit bei dessen Auswertung<br />
walten lassen. Wirklich Neues<br />
erfährt man über Henze kaum, und die<br />
Empathie des Autors schlägt gelegentlich<br />
ins Pathos um, aber: Rosteck dürfte<br />
es zweifellos gelingen, Henze ins Gespräch<br />
zu bringen. ●<br />
31. Januar 2010 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 21<br />
MarcO BOrggreve / LaiF