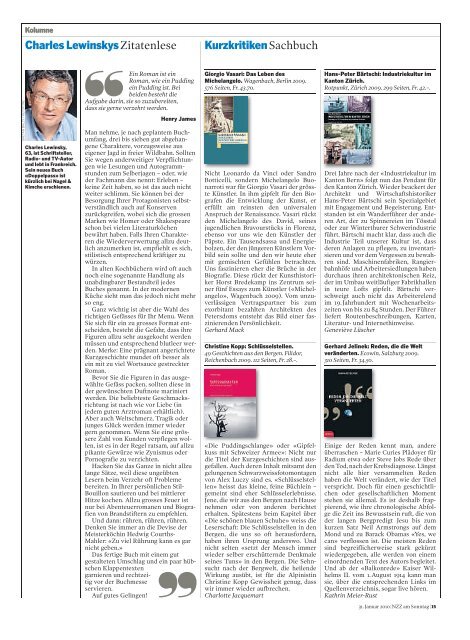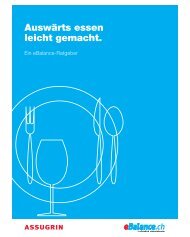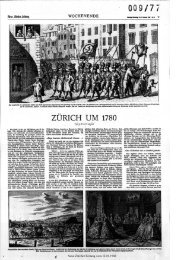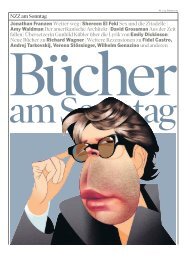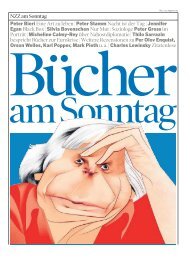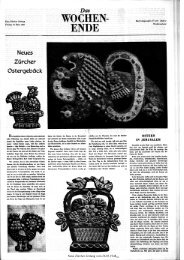Marcel Proust Hommage von Andreas Isenschmid |Sigmund Freud ...
Marcel Proust Hommage von Andreas Isenschmid |Sigmund Freud ...
Marcel Proust Hommage von Andreas Isenschmid |Sigmund Freud ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
gaËtan BaLLY / KeYstOne<br />
Kolumne<br />
Charles Lewinskys Zitatenlese<br />
Charles Lewinsky,<br />
63, ist Schriftsteller,<br />
Radio- und TV-Autor<br />
und lebt in Frankreich.<br />
Sein neues Buch<br />
«Doppelpass» ist<br />
kürzlich bei Nagel &<br />
Kimche erschienen.<br />
Ein Roman ist ein<br />
Roman, wie ein Pudding<br />
ein Pudding ist. Bei<br />
beiden besteht die<br />
Aufgabe darin, sie so zuzubereiten,<br />
dass sie gerne verzehrt werden.<br />
Henry James<br />
Man nehme, je nach geplantem Buchumfang,<br />
drei bis sieben gut abgehangene<br />
Charaktere, vorzugsweise aus<br />
eigener Jagd in freier Wildbahn. Sollten<br />
Sie wegen anderweitiger Verpflichtungen<br />
wie Lesungen und Autogrammstunden<br />
zum Selberjagen – oder, wie<br />
der Fachmann das nennt: Erleben –<br />
keine Zeit haben, so ist das auch nicht<br />
weiter schlimm. Sie können bei der<br />
Besorgung Ihrer Protagonisten selbstverständlich<br />
auch auf Konserven<br />
zurückgreifen, wobei sich die grossen<br />
Marken wie Homer oder Shakespeare<br />
schon bei vielen Literaturköchen<br />
bewährt haben. Falls Ihren Charakteren<br />
die Wiederverwertung allzu deutlich<br />
anzumerken ist, empfiehlt es sich,<br />
stilistisch entsprechend kräftiger zu<br />
würzen.<br />
In alten Kochbüchern wird oft auch<br />
noch eine sogenannte Handlung als<br />
unabdingbarer Bestandteil jedes<br />
Buches genannt. In der modernen<br />
Küche sieht man das jedoch nicht mehr<br />
so eng.<br />
Ganz wichtig ist aber die Wahl des<br />
richtigen Gefässes für Ihr Menu. Wenn<br />
Sie sich für ein zu grosses Format entscheiden,<br />
besteht die Gefahr, dass ihre<br />
Figuren allzu sehr ausgekocht werden<br />
müssen und entsprechend blutleer werden.<br />
Merke: Eine prägnant angerichtete<br />
Kurzgeschichte mundet oft besser als<br />
ein mit zu viel Wortsauce gestreckter<br />
Roman.<br />
Bevor Sie die Figuren in das ausgewählte<br />
Gefäss packen, sollten diese in<br />
der gewünschten Duftnote mariniert<br />
werden. Die beliebteste Geschmacksrichtung<br />
ist nach wie vor Liebe (in<br />
jedem guten Arztroman erhältlich).<br />
Aber auch Weltschmerz, Tragik oder<br />
junges Glück werden immer wieder<br />
gern genommen. Wenn Sie eine grössere<br />
Zahl <strong>von</strong> Kunden verpflegen wollen,<br />
ist es in der Regel ratsam, auf allzu<br />
pikante Gewürze wie Zynismus oder<br />
Pornografie zu verzichten.<br />
Hacken Sie das Ganze in nicht allzu<br />
lange Sätze, weil diese ungeübten<br />
Lesern beim Verzehr oft Probleme<br />
bereiten. In Ihrer persönlichen Stil-<br />
Bouillon sautieren und bei mittlerer<br />
Hitze kochen. Allzu grosses Feuer ist<br />
nur bei Abenteuerromanen und Biografien<br />
<strong>von</strong> Brandstiftern zu empfehlen.<br />
Und dann: rühren, rühren, rühren.<br />
Denken Sie immer an die Devise der<br />
Meisterköchin Hedwig Courths-<br />
Mahler: «Zu viel Rührung kann es gar<br />
nicht geben.»<br />
Das fertige Buch mit einem gut<br />
gestalteten Umschlag und ein paar hübschen<br />
Klappentexten<br />
garnieren und rechtzeitig<br />
vor der Buchmesse<br />
servieren.<br />
Auf gutes Gelingen!<br />
Kurzkritiken Sachbuch<br />
Giorgio Vasari: Das Leben des<br />
Michelangelo. Wagenbach, Berlin 2009.<br />
576 Seiten, Fr.43.70.<br />
Nicht Leonardo da Vinci oder Sandro<br />
Botticelli, sondern Michelangelo Buonarroti<br />
war für Giorgio Vasari der grösste<br />
Künstler. In ihm gipfelt für den Biografen<br />
die Entwicklung der Kunst, er<br />
erfüllt am reinsten den universalen<br />
Anspruch der Renaissance. Vasari rückt<br />
den Michelangelo des David, seines<br />
jugendlichen Bravourstücks in Florenz,<br />
ebenso vor uns wie den Künstler der<br />
Päpste. Ein Tausendsassa und Energiebolzen,<br />
der den jüngeren Künstlern Vorbild<br />
sein sollte und den wir heute eher<br />
mit gemischten Gefühlen betrachten.<br />
Uns faszinieren eher die Brüche in der<br />
Biografie. Diese rückt der Kunsthistoriker<br />
Horst Bredekamp ins Zentrum seiner<br />
fünf Essays zum Künstler («Michelangelo»,<br />
Wagenbach 2009). Vom unzuverlässigen<br />
Vertragspartner bis zum<br />
exorbitant bezahlten Architekten des<br />
Petersdoms entsteht das Bild einer faszinierenden<br />
Persönlichkeit.<br />
Gerhard Mack<br />
Christine Kopp: Schlüsselstellen.<br />
49 Geschichten aus den Bergen. Filidor,<br />
Reichenbach 2009. 112 Seiten, Fr.28.–.<br />
«Die Puddingschlange» oder «Gipfelkuss<br />
mit Schweizer Armee»: Nicht nur<br />
die Titel der Kurzgeschichten sind ausgefallen.<br />
Auch deren Inhalt mitsamt den<br />
gelungenen Schwarzweissfotomontagen<br />
<strong>von</strong> Alex Luczy sind es. «Schlüsselstellen»<br />
heisst das kleine, feine Büchlein –<br />
gemeint sind eher Schlüsselerlebnisse.<br />
Jene, die wir aus den Bergen nach Hause<br />
nehmen oder <strong>von</strong> anderen berichtet<br />
erhalten. Spätestens beim Kapitel über<br />
«Die schönen blauen Schuhe» weiss die<br />
Leserschaft: Die Schlüsselstellen in den<br />
Bergen, die uns so oft herausfordern,<br />
haben ihren Ursprung anderswo. Und<br />
nicht selten «setzt der Mensch immer<br />
wieder selber erschütternde Denkmale<br />
seines Tuns» in den Bergen. Die Sehnsucht<br />
nach der Bergwelt, die heilende<br />
Wirkung ausübt, ist für die Alpinistin<br />
Christine Kopp Gewissheit genug, dass<br />
wir immer wieder aufbrechen.<br />
Charlotte Jacquemart<br />
Hans-Peter Bärtschi: Industriekultur im<br />
Kanton Zürich.<br />
Rotpunkt, Zürich 2009. 299 Seiten, Fr.42.–.<br />
Drei Jahre nach der «Industriekultur im<br />
Kanton Bern» folgt nun das Pendant für<br />
den Kanton Zürich. Wieder beackert der<br />
Architekt und Wirtschaftshistoriker<br />
Hans-Peter Bärtschi sein Spezialgebiet<br />
mit Engagement und Begeisterung. Entstanden<br />
ist ein Wanderführer der anderen<br />
Art, der zu Spinnereien im Tösstal<br />
oder zur Winterthurer Schwerindustrie<br />
führt. Bärtschi macht klar, dass auch die<br />
Industrie Teil unserer Kultur ist, dass<br />
deren Anlagen zu pflegen, zu inventarisieren<br />
und vor dem Vergessen zu bewahren<br />
sind. Maschinenfabriken, Rangierbahnhöfe<br />
und Arbeitersiedlungen haben<br />
durchaus ihren architektonischen Reiz,<br />
der im Umbau weitläufiger Fabrikhallen<br />
in teure Lofts gipfelt. Bärtschi verschweigt<br />
auch nicht das Arbeiterelend<br />
im 19.Jahrhundert mit Wochenarbeitszeiten<br />
<strong>von</strong> bis zu 84 Stunden. Der Führer<br />
liefert Routenbeschreibungen, Karten,<br />
Literatur- und Internethinweise.<br />
Geneviève Lüscher<br />
Gerhard Jelinek: Reden, die die Welt<br />
veränderten. Ecowin, Salzburg2009.<br />
310 Seiten, Fr.34.50.<br />
Einige der Reden kennt man, andere<br />
überraschen – Marie Curies Plädoyer für<br />
Radium etwa oder Steve Jobs Rede über<br />
den Tod, nach der Krebsdiagnose. Längst<br />
nicht alle hier versammelten Reden<br />
haben die Welt verändert, wie der Titel<br />
verspricht. Doch für einen geschichtlichen<br />
oder gesellschaftlichen Moment<br />
stehen sie allemal. Es ist deshalb frappierend,<br />
wie ihre chronologische Abfolge<br />
die Zeit ins Bewusstsein ruft, die <strong>von</strong><br />
der langen Bergpredigt Jesu bis zum<br />
kurzen Satz Neil Armstrongs auf dem<br />
Mond und zu Barack Obamas «Yes, we<br />
can» verflossen ist. Die meisten Reden<br />
sind begreiflicherweise stark gekürzt<br />
wiedergegeben, alle werden <strong>von</strong> einem<br />
einordnenden Text des Autors begleitet.<br />
Und ab der «Balkonrede» Kaiser Wilhelms<br />
II. vom 1.August 1914 kann man<br />
sie, über die entsprechenden Links im<br />
Quellenverzeichnis, sogar live hören.<br />
Kathrin Meier-Rust<br />
31. Januar 2010 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 15