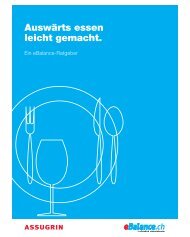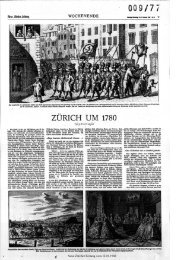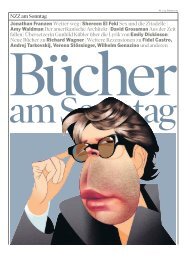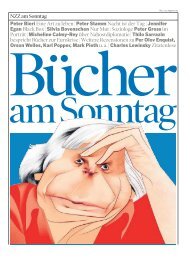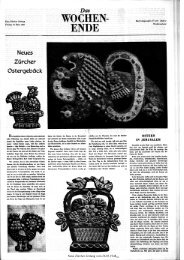Marcel Proust Hommage von Andreas Isenschmid |Sigmund Freud ...
Marcel Proust Hommage von Andreas Isenschmid |Sigmund Freud ...
Marcel Proust Hommage von Andreas Isenschmid |Sigmund Freud ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Sachbuch<br />
Erwerbslosigkeit Je mehr Langzeitarbeitslose,destomehr Fantasie braucht die Gesellschaftzur<br />
Lösung der sozialen Frage. Die Stiftung für Arbeit in St.Gallen zeigt, wie es funktionieren kann<br />
Arbeiten istmehr<br />
alsblosse Beschäftigung<br />
Lynn Blattmann, Daniela Merz:<br />
Sozialfirmen. Plädoyerfür eine<br />
unternehmerische Arbeitsintegration.<br />
Rüffer&Rub,Zürich 2010.176 S., Fr.38.–.<br />
Von Charlotte Jacquemart<br />
Wäre das Buch «Sozialfirmen» lediglich<br />
eine weitere theoretische Abhandlung:<br />
Wir würden es an dieser Stelle<br />
kaum besprechen. Doch es ist glücklicherweise<br />
weit mehr als graue Theorie.<br />
Es ist eine präzise Handlungsanleitung<br />
für alle, die versuchen, Langzeitarbeitslose<br />
in eine Art «zweiten» Arbeitsmarkt<br />
zu integrieren. Zudem beruht<br />
die verständlich geschriebene Anleitung<br />
nicht auf betriebswirtschaftlicher<br />
Theorie aus dem Elfenbeinturm der<br />
Wissenschaft, sondern auf praktischen<br />
Erfahrungen der «Stiftung für Arbeit»<br />
in St.Gallen, die seit 2002 das Konzept<br />
mit viel Erfolg umsetzt. Die Geschäftsführerin<br />
Daniela Merz – Schwiegertochter<br />
<strong>von</strong> Bundesrat Merz – hat das<br />
Buch zusammen mit ihrer Stellvertreterin<br />
Lynn Blattmann denn auch gleich<br />
selbst geschrieben.<br />
Niemand zweifelt daran, dass auch in<br />
der Schweiz neue Modelle zum Umgang<br />
mit der Sockelarbeitslosigkeit nötig<br />
sind. Denn diese steigt auch hierzulande<br />
an. Zwischen drei und vier Prozent der<br />
im Erwerbsalter stehenden Personen<br />
18 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 31. Januar 2010<br />
Karin hOFer<br />
sind ausgesteuert; 233484 Personen<br />
lebten 2007 <strong>von</strong> der Sozialhilfe. Zählt<br />
man die Bezüger <strong>von</strong> Invalidenrenten<br />
und Arbeitslosenentschädigungen dazu,<br />
wird deutlich, dass um die zehn Prozent<br />
der Bevölkerung im erwerbsfähigen<br />
Alter dauerhaft vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen<br />
sind. Weil sich selbst reiche<br />
Staaten wie die Schweiz steigende<br />
Sozialkosten kaum mehr leisten können,<br />
dürfte die Idee <strong>von</strong> marktwirtschaftlich<br />
geführten Sozialfirmen in Zukunft an<br />
Bedeutung gewinnen. Heute schon gibt<br />
die Schweiz über 3,2 Mrd. Franken für<br />
Sozialhilfe aus. Nur wenn die Betroffenen<br />
mit eigener Arbeit ein anständiges<br />
Daniela Merz, Chefin<br />
der Stiftung für Arbeit<br />
in St. Gallen.<br />
Einkommen erzielen, können diese Kosten<br />
gesenkt werden.<br />
Das Sozialunternehmen tritt an die<br />
heute nur ungenügend funktionierende<br />
Schnittstelle zwischen Staat und Privaten:<br />
Indem man Menschen, die heute<br />
vom «ersten» Arbeitsmarkt ausgeschlossen<br />
sind, eine sinnvolle und<br />
bezahlte Tätigkeit im «zweiten» Arbeitsmarkt<br />
anbietet, gelingt es nicht nur, den<br />
Betroffenen wieder einen Lebensinhalt<br />
zu geben, sondern man verbessert<br />
zusätzlich die Gesamtleistung einer<br />
Gesellschaft. Ziel ist, dass möglichst<br />
viele, die sich erfolgreich in eine Sozialfirma<br />
integrieren können, den Sprung<br />
zurück in den normalen Arbeitsmarkt<br />
finden. Das Beispiel St.Gallen zeigt, dass<br />
es möglich ist, Firmen zu finden, die<br />
Aufträge an Sozialfirmen vergeben. Und<br />
zwar nachhaltig: Waren beim Start im<br />
Jahr 2002 weit unter 100 Mitarbeiter mit<br />
dabei, sind es heute über 700 in St. Gallen,<br />
Arbon, Zürich und Winterthur.<br />
Vor allem im Bereich der industriellen<br />
oder industrienahen Arbeiten orten<br />
die Autorinnen ein grosses Potenzial für<br />
Aufträge an Sozialfirmen. Doch auch für<br />
Sozialfirmen gilt: Niemand vergibt<br />
Arbeitsaufträge aus sozialen Gründen –<br />
Qualität und Leistung der Arbeit müssen<br />
stimmen. Gerade darauf dürfte der<br />
Erfolg des St. Galler Modells beruhen.<br />
Bleibt zu hoffen, dass das Beispiel weiter<br />
Schule macht. ●<br />
Schweiz Nunbefasst sich auch der Wissenschaftsbetriebmit 1968 –eine Nachzügler-Publikation<br />
Das«bewegte» Jahrzehntinder Analyse<br />
Janick Marina Schaufelbuehl (Hrsg.):<br />
1968–1978. Ein bewegtes Jahrzehnt in<br />
der Schweiz. UnterMitarbeit <strong>von</strong>Nuno<br />
Pereiraund Renate Schär.<br />
Chronos, Zürich 2009. 333 Seiten, Fr.48.–.<br />
Von Urs Rauber<br />
Ein halbes Dutzend Bücher sind vor<br />
knapp zwei Jahren zum 40. Jahrestag <strong>von</strong><br />
1968 in der Schweiz erschienen, vornehmlich<br />
aus der Feder <strong>von</strong> Altachtundsechzigern.<br />
Inzwischen ist das<br />
Geschichtskapitel definitiv zum Forschungsgebiet<br />
der Wissenschaft geworden.<br />
Ein vom Nationalfonds unterstützter<br />
neuer Sammelband vereinigt 19<br />
Beiträge, die vor allem auf Lizentiatsarbeiten<br />
und Dissertationen der letzten<br />
Jahre fussen. Ging es den schreibenden<br />
Veteranen noch darum, sich die Deutungshoheit<br />
über ihre Geschichte nicht<br />
entreissen zu lassen, gehen jüngere Historiker<br />
nun unbefangener ans Werk.<br />
Eingeleitet wird der Reader zum<br />
«bewegten Jahrzehnt» durch einen Aufsatz<br />
der Berner Geschichtsordinaria<br />
Brigitte Studer und der Lausanner Historikerin<br />
Janick Marina Schaufelbuehl.<br />
Ihre Behauptung, in der Schweiz seien<br />
«die biografischen und subjektiven Ebenen»<br />
der 68er Bewegung noch «kaum<br />
erschlossen», überzeugt indes nicht.<br />
Verwiesen sei etwa auf die Biografiensammlung<br />
<strong>von</strong> Heinz Nigg «Wir sind<br />
wenige, aber wir sind alle» (Limmat,<br />
Zürich 2008) und andere Publikationen.<br />
Den Abschluss des Bandes bildet ein<br />
länglicher Syntheseversuch des Wirtschafts-<br />
und Sozialhistorikers Jean<br />
Batou, der an der Uni Lausanne Oral-<br />
History-Seminare zum Thema durchgeführt<br />
hat.<br />
Die übrigen, kürzeren Beiträge kreisen<br />
um vier Themenkomplexe: den globalen<br />
Kontext der schweizerischen 68er<br />
Bewegung, die Dritte-Welt-Solidarität<br />
(«Tiermondismus»), die Geschlechterbeziehungen<br />
sowie Äusserungen der<br />
Alternativkultur. Darin finden sich etliche<br />
kritische Töne – zum Revolutionsromantizismus<br />
etwa oder zur Fehleinschätzung<br />
der Befreiungsbewegungen<br />
durch die 68er Aktivisten.<br />
Leider steht jeder Aufsatz für sich, so<br />
dass kein Buch aus einem Guss entstanden<br />
ist. Zu bedauern ist ferner, dass<br />
mehrere Beiträge im Jargon universitärer<br />
Seminararbeiten geschrieben sind<br />
und kaum zu neuen Erkenntnissen vorstossen.<br />
Wenig zu befriedigen vermag<br />
auch das Konzept der Zweisprachigkeit:<br />
Während die Kapiteleinleitungen in<br />
Deutsch und Französisch publiziert<br />
werden, vermisst man die Übersetzung<br />
oder zumindest eine Zusammenfassung<br />
in der jeweils anderen Sprache beim<br />
Einleitungs- und Schlussbeitrag. Da<br />
auch eine zentrale Bibliografie, ein Sachund<br />
Personenregister sowie Angaben zu<br />
den weitgehend unbekannten Autorinnen<br />
und Autoren fehlen, drängt sich die<br />
Bewertung auf: trotz einzelnen Pluspunkten<br />
eher misslungen. ●