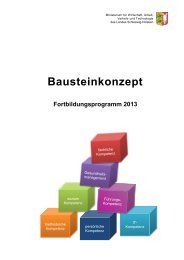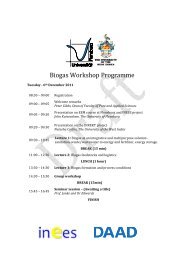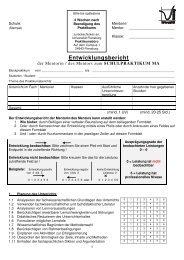Matthias Bauer: Liebe Deinen Replikanten wie Dich selbst
Matthias Bauer: Liebe Deinen Replikanten wie Dich selbst
Matthias Bauer: Liebe Deinen Replikanten wie Dich selbst
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Das wird noch deutlicher, wenn man The Blade Runner auf die Tradition<br />
der Darstellung künstlicher Menschen im Film und in der Literatur bezieht.<br />
Nicht nur in Fritz Langs Metropolis (1927), auch in den unzähligen Versio-<br />
nen des Frankenstein-Mythos, aber auch in dem zu Unrecht häufig igno-<br />
rierten Roman DIE EVA DER ZUKUNFT (1886) von Jean-Marie Villiers de l’Isle<br />
Adam wird die Andreide entweder, <strong>wie</strong> bei Mary Shelley, gar nicht erst<br />
zum Leben erweckt oder so bald als möglich vernichtet, weil der prome-<br />
thische Mann in ihr nur eine gefährliche Infragestellung seiner schöpferischen<br />
Potenz und Autonomie sehen kann. Echte Gefühle zu haben, wird<br />
der künstlichen Frau ebenso verwehrt <strong>wie</strong> das Anrecht darauf, als Mensch<br />
behandelt zu werden. In James Whales The Bride of Frankenstein (1935)<br />
etwa kann das arme Geschöpf im Gegensatz zum männlichen Monster,<br />
das über einen vergleichsweise elaborierten Code verfügt, lediglich spitze,<br />
grelle Schreckensschreie ausstoßen, bevor es, kaum das es existiert, auch<br />
schon <strong>wie</strong>der annihiliert wird.<br />
*<br />
Gerade im Vergleich mit den Geschichten von künstlichen Menschen, die<br />
im Kino vor The Blade Runner erzählt worden sind, aber auch im Vergleich<br />
mit der Romanvorlage, zeigt sich somit, dass Ridley Scott über die Variation<br />
des Themas hinaus zu einer innovativen Sicht der Dinge gelangt ist.<br />
Hervorzuheben ist dabei zum einen, dass er zum ersten Mal in der Literatur-<br />
und Filmgeschichte weibliche künstliche Menschen präsentiert, die<br />
überleben und deren Kampf um Anerkennung nicht diskreditiert wird. Zum<br />
anderen scheint der eigentliche Clou von Scotts Romanverfilmung gerade<br />
darin zu bestehen, dass ein Replikant, der sich <strong>wie</strong> Roy Batty, Rachael Rosen<br />
oder Rick Deckard verhält, ziemlich genau dem Bild entspricht, das<br />
Albert Camus vom „Mensch in der Revolte“ gezeichnet hat:<br />
„Was ist der Mensch in der Revolte? Ein Mensch, der nein sagt. [...] Er<br />
schritt unter der Peitsche des Herrn. Nun bietet er ihm die Stirn“, 15 heißt<br />
es bei Camus. Zwei wichtige Bemerkungen ergänzen dieses Bild vom Menschen<br />
in der Revolte. Erstens verweist Camus auf die deontische bzw. ethische<br />
Dimension der Revolte: „Scheinbar negativ, da sie nichts erschafft,<br />
15 Albert Camus: Der Mensch in der Revolte. Essays. Reinbek bei Hamburg 1988 [Französische Erstausgabe<br />
1951], S. 14. Wenn Roy Batty im Film seinem ‚Vater‘, dem Roboterhersteller Tyrell, die Stirn bietet und verlangt,<br />
die Termination seiner Existenz aufzuheben, und diesem dann, nachdem er sich von der technischen Unmöglichkeit<br />
überzeugen musste, dass dieser Wunsch erfüllt werden könnte, die Augen eindrückt, reagiert er<br />
ähnlich <strong>wie</strong> Frankensteins Monster, nachdem ihm sein Schöpfer das Recht auf ein Mit-Geschöpf verwehrt hat.<br />
12