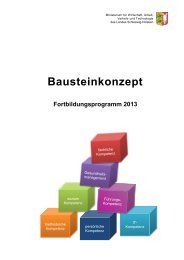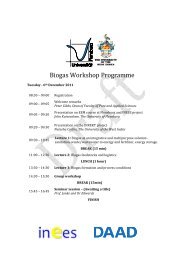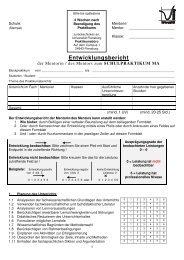Matthias Bauer: Liebe Deinen Replikanten wie Dich selbst
Matthias Bauer: Liebe Deinen Replikanten wie Dich selbst
Matthias Bauer: Liebe Deinen Replikanten wie Dich selbst
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
tenberg hatte freilich bemerkt, dass man vielleicht besser davon sprechen<br />
sollte, das „es denkt“, so <strong>wie</strong> man sagt, dass „es blitzt“, weil ohne weiteres<br />
gar nicht ausgemacht ist, ob das „Ich“ nicht ein Epiphänomen des<br />
Denkens sei, das Denken aber letztlich eine emergente Erscheinung, die<br />
sich im Kräftespiel der Natur gleichsam evolutionär ergeben hat. Zwar findet<br />
man diese Genealogie des Denkens so formuliert noch nicht bei Lichtenberg,<br />
ansatzweise aber bei Philosophen <strong>wie</strong> Friedrich Nietzsche oder<br />
Charles Sanders Peirce, Alfred North Whitehead, Henri Bergson oder Sigmund<br />
Freud, der das Ich aus ähnlichen Gründen zugunsten des Es relativiert<br />
hat. Zugespitzt lautet die Antithese zu Descartes, dass das Denken in<br />
der Plastizität der durch und durch unpersönlichen Materie angelegt ist<br />
und dass seine Zuschreibung zu einem Subjekt lediglich die für den Menschen<br />
besonders praktische Lesart ist, auf die sich sein sprachliches und<br />
sonstiges Verhalten eingependelt hat, weil sich diese Lesart evolutionär<br />
bewährt hat, also soziale und psychologische Vorteile bringt.<br />
Bezieht man den SOLARIS-Roman und die beiden Filme von Tarkowskij und<br />
Soderbergh auf das von Descartes exponierte Problem der modernen Ontologie,<br />
Epistemologie und Anthropologie, so wird jeweils die konstitutive<br />
Rolle der Imagination deutlich. Der Unterschied liegt darin, dass Descartes<br />
in seiner Versuchsanordnung die Selbstreferenz des Denkens, Lem, Tarkowskij<br />
und Soderbergh, aber auch Dick und Scott offensichtlich die<br />
Fremdreferenz des Empfindens für ausschlaggebend halten. Die Schlüsselbemerkung,<br />
auf die es bei Lem <strong>wie</strong> bei Tarkowskij und Soderbergh ankommt,<br />
lautet daher: „Wir brauchen keine anderen Welten. Wir brauchen<br />
Spiegel [oder „Abbilder“, <strong>wie</strong> es in einigen Übersetzungen heißt MB]. Mit<br />
anderen Welten können wir nichts anfangen.“ Wohl aber, <strong>wie</strong> man ergänzen<br />
darf, mit anderen Menschen, deren <strong>Replikanten</strong> oder Replikationen wir<br />
auf der Leinwand begegnen.<br />
Sieht man den Kino-Apparat mithin als Maschine und den Prozess der<br />
Filmwahrnehmung und –deutung als eine Form der Interaktion, erscheint<br />
die melodramatisch inszenierte Menschwerdung einer Maschine, die dabei<br />
zum 'inneren Objekt' der psycho-semiotischen Aktivität eines Menschen<br />
wird, als gleichnishafte Veranschaulichung der Vermittlung humaner Werte,<br />
die das Medium leistet. Was auf der Leinwand geschieht, reflektiert,<br />
was sich im empathischen Feld ereignen soll. Indem die psychosemiotische<br />
Aktivität diese Implikatur realisiert, verwandelt sie die Illusionsmaschinerie<br />
des Kinos in ein Programm der Menschwerdung.<br />
27