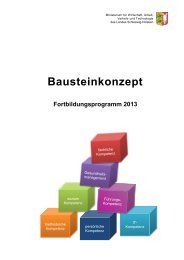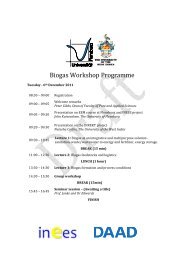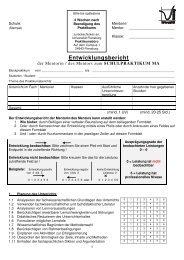Matthias Bauer: Liebe Deinen Replikanten wie Dich selbst
Matthias Bauer: Liebe Deinen Replikanten wie Dich selbst
Matthias Bauer: Liebe Deinen Replikanten wie Dich selbst
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>wie</strong> dort handelt es sich um die systematische Ausstattung eines Gehirns<br />
mit Leitmotiven aus einer vergangenen Epoche, um den zusammengesetzten<br />
‚Individuen‘ lebensgeschichtliche Tiefe zu verleihen, eine Art Vorgeschichte,<br />
die sie als vermutlich künstliche Wesen sonst entbehren müß-<br />
ten.“ 31<br />
Die Frage muss erlaubt sein, was uns Mediensubjekte, die wir tagtäglich<br />
einer vom Recycling lebenden Bewusstseinsindustrie unterworfen – also<br />
sub-jectum – sind, eigentlich noch vom Gemütszustand der <strong>Replikanten</strong><br />
mit ihren Gehirnimplantaten unterscheidet? Man kann diese Frage als<br />
Hinweis auf einen weit verbreiteten Irrtum verstehen – den Irrtum nämlich,<br />
dass die Bedeutung von Empfindungen davon abhängt, dass sie eine<br />
authentische Genese haben. Offenbar ist dies nicht der Fall. Zumindest im<br />
Kino ist die Inauthentizität dessen, was der Zuschauer wahrnimmt, die<br />
Bedingung der Möglichkeit, wahrhaftig etwas zu empfinden und dieser<br />
Empfindung einen Wert zuzuschreiben, der bloß deswegen, weil er fiktional<br />
oder imaginär entworfen und entfaltet wird, keineswegs illusorisch ist.<br />
In diesem Sinne ist der Film, ist vor allem das filmische Melodram, das<br />
Simulakrum einer Interaktion zwischen dem Subjekt, das sich imaginär<br />
konstituiert, und dem signifikanten Anderen, der seine Rolle nur spielen<br />
kann, indem er von einem unmittelbaren Objekt der Wahrnehmung in das<br />
dynamische Objekt einer Deutung verwandelt wird, die sich das beständige<br />
Hin und Her zwischen Projektion und Introjektion, Fremdreferenz und<br />
Selbstreferenz zunutze macht, das der szenografische Diskurs anstößt. So<br />
gesehen, ist das Melodram nicht einfach nur ein Genre, sondern eine Implikatur,<br />
die sich im Verlauf der psycho-semiotischen Aktivität des Zuschauers<br />
entfaltet. Im Unterschied zu einer Implikation, deren Auflösung<br />
eine logische und semantische Kompetenz erfordert, stellt die Implikatur<br />
ein pragmatisches Phänomen dar, das performativ entfaltet wird durch die<br />
Art und Weise, <strong>wie</strong> sich ein Subjekt zu Bezugsobjekten verhält, die im<br />
empathischen Feld mit zum Teil sehr hohen Affektbeträgen ausgestattet<br />
werden. Und eben darin, in der performativen Entfaltung, ist sowohl die<br />
soziale als auch die ethische Dimension des Melodramas angelegt.<br />
*<br />
31 Thomas Koebner: Herr und Knecht. Über künstliche Menschen im Film. In: Derselbe: Halbnah. Schriften zum<br />
Film. Zweite Folge. St. Augustin 1999, S. 75-91, Zitat S. 85.<br />
19