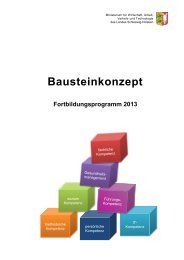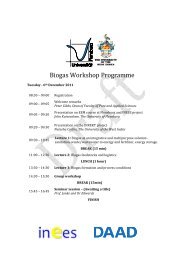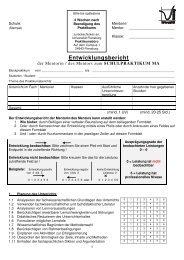Matthias Bauer: Liebe Deinen Replikanten wie Dich selbst
Matthias Bauer: Liebe Deinen Replikanten wie Dich selbst
Matthias Bauer: Liebe Deinen Replikanten wie Dich selbst
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
genter Konfliktverläufe geht, würde der kognitive Mehrwert der Inszenie-<br />
rung erheblich geschmälert. Man muss daher das filmische Melodram als<br />
Medium der Erkenntnisvermittlung im Modus der Gefühlserregung verstehen,<br />
hat damit aber noch nicht sein Spezifikum erfasst. Denn um Erkenntnisvermittlung<br />
im Modus der Gefühlserregung geht es ja fast immer im<br />
Kino und überhaupt in allen dramatisch erzählten Geschichten (was <strong>wie</strong>derum<br />
erklärt, warum das filmische Melodram als Paradigma für die Wirkungsästhetik<br />
des Kinos gilt).<br />
Um nun der spezifischen Pointe der Themenentfaltung in The Blade Runner<br />
auf die Spur zu kommen und zu begreifen, <strong>wie</strong> der Vorgang der<br />
Menschwerdung einer Maschine mit der psycho-semiotischen Aktivität des<br />
Zuschauers und der Inszenierung einer artifiziellen Innerlichkeit zusammenhängt,<br />
empfiehlt es sich, Scotts Film mit seiner Textvorlage zu vergleichen:<br />
In seinem 1968 unter dem Titel DO ANDROIDS DREAM OF ELECTRIC SHEEP?<br />
erstmals veröffentlichten Roman stellt Philip K. Dick (1928-1982) zwar das<br />
auch für Ridley Scott entscheidende Problem der Un-Unterscheidbarkeit<br />
von Mensch und Maschine, von homo sapiens und Replikant heraus, nutzt<br />
aber nur in sehr begrenztem Maße die Möglichkeiten des Melodrams, um<br />
dieses Problem zu veranschaulichen. Insbesondere die Figur der Rachael<br />
Rosen erfüllt im Roman eine ganz andere Funktion als im Film. Bei Dick<br />
setzt sie ihre erotische Verführungskraft ebenso zielstrebig <strong>wie</strong> kaltschnäuzig<br />
lediglich dazu ein, <strong>Replikanten</strong>jäger <strong>wie</strong> Rick Deckard in ihrer<br />
beruflichen Identität zu verunsichern. Das mag auch damit zusammenhängen,<br />
dass Deckard bei Dick mit Iran verheiratet ist, die ihn gleich zu<br />
Beginn der Geschichte als „Mörder“ apostrophiert, 10 weil er keinerlei Mitleid<br />
mit den Androiden empfindet, die sie liebevoll als „Andys“ bezeichnet.<br />
Der Erzähler kommentiert diese Gefühllosigkeit einige Seiten später mit<br />
den Worten:<br />
„Für Rick Deckard war ein entsprungener Androide, der seinen Herrn getötet<br />
hatte, der über eine größere Intelligenz als viele menschliche Wesen<br />
verfügte, der keine Tierliebe zeigte, der nicht die Fähigkeit besaß, empa-<br />
10 Vgl. Philip K. Dick: Blade Runner. Roman. Überarbeitete Neuausgabe. Deutsche Übersetzung von Norbert<br />
Wölfl, durchgesehen und ergänzt von Jacqueline Dougoud 2. Auflage. München 2002, S. 9.<br />
7