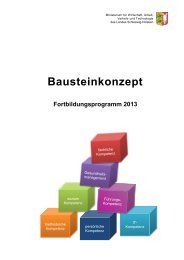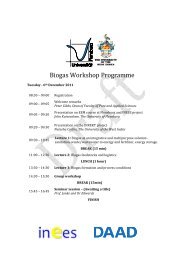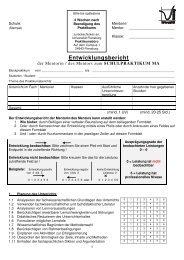Matthias Bauer: Liebe Deinen Replikanten wie Dich selbst
Matthias Bauer: Liebe Deinen Replikanten wie Dich selbst
Matthias Bauer: Liebe Deinen Replikanten wie Dich selbst
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Menschen in sich zu haben.“ 20 Das aber bedeutet nicht nur, dass das Ge-<br />
hirn zur Wahrnehmung und inneren Abbildung anderer Menschen diesel-<br />
ben Programme einsetzt, mit denen es auch ein Bild von sich <strong>selbst</strong> mo-<br />
delliert. 21 Es bedeutet darüber hinaus, dass die Wahrnehmung und Reprä-<br />
sentation einer menschlichen Gestalt auf der Leinwand tatsächlich insofern<br />
der Herstellung eines <strong>Replikanten</strong> gleicht, als es dabei um die Identifikation<br />
mit dem dynamischen Objekt geht, das im empathischen Feld entsteht.<br />
Die spontanen Simulationen der Gefühlsregungen, die ein Schauspieler auf<br />
der Leinwand ausdrückt, werden im Rahmen der psycho-semiotischen Aktivität,<br />
die mit der Aktivität der Spiegelneuronen beginnt, zu einer vergleichsweise<br />
stabilen Repräsentation entwickelt, in der sich zwei Bilder<br />
von Personen ineinander spiegeln: das der eigenen Person und das einer<br />
Bezugsperson. In diesem Sinne ist der Replikant eine Allegorie der neuronalen<br />
Replikationen, die Menschen im Prozess der Identifikation mit einem<br />
signifikanten Anderen – sei es nun in der Realität oder in der Fiktion – erzeugen.<br />
Dabei ist die Simulation klar und deutlich von der Verhaltensimitation<br />
zu unterscheiden: Die ‚Spiegelneuronen‘ feuern, doch die eigene<br />
Bewegung wird inhibitiert. Gleichwohl findet in der Imagination offenbar<br />
statt, was George Herbert Mead auf die Formel „to take the role of the other“<br />
gebracht hat. 22 Der sentimentale Vorgang der Identifikation einer<br />
Zuschauerin oder eines Zuschauers mit Figuren <strong>wie</strong> Rachael Rosen oder<br />
Rick Deckard ist also kein Indiz von Naivität, sondern genau das, was man<br />
als die basale Interaktion bzw. als den immer <strong>wie</strong>der von neuem erforderlichen<br />
Akt der Konstitution einer humanen Gesellschaft bezeichnen könnte.<br />
Indem die Schlüsselszene von The Blade Runner diesen Vorgang modelliert<br />
und an das Bild vom Menschen in der Revolte koppelt, erhält der<br />
Film eine ethische Dimension, die über das empathische Feld hinausweist,<br />
das sich in seiner Wahrnehmung und Deutung bildet. Daher kann man mit<br />
Thomas Koebner über Scotts Film sagen:<br />
„Er definiert Menschlichkeit nicht traditionalistisch, etwa durch biologische<br />
Er[b]folge, Stammbaum, Familie – dies scheinen nur veraltete Vehikel<br />
bürgerlicher Selbstfindung aus verflossenen Tagen zu sein. Er definiert sie<br />
20 <strong>Bauer</strong>, S. 86.<br />
21 Vgl. <strong>Bauer</strong>, S. 165f.<br />
22 Vgl. George Herbert Mead: Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus. Aus dem<br />
Amerikanischen von Ulf Pacher. Frankfurt am Main 1993. Dort heißt es auf S. 300 über die soziale Person:<br />
„Indem sie diese Rolle der anderen übernimmt, kann sie sich auf sich <strong>selbst</strong> besinnen und so ihren eigenen<br />
Kommunikationsprozeß lenken. Diese Übernahme der Rolle anderer [...] ist nicht nur zeitweilig von Bedeutung<br />
[...], sondern für die Entwicklung der kooperativen Gesellschaft wichtig.“ Siehe auch den Abschnitt ‚Über das<br />
Wesen des Mitgefühls‘, S. 346-350.<br />
14