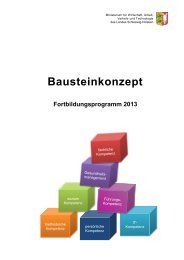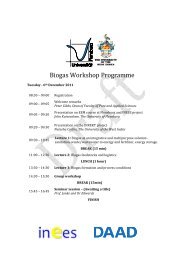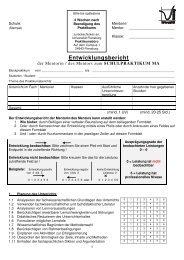Matthias Bauer: Liebe Deinen Replikanten wie Dich selbst
Matthias Bauer: Liebe Deinen Replikanten wie Dich selbst
Matthias Bauer: Liebe Deinen Replikanten wie Dich selbst
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
schen zu identifizieren und ‚abzuschalten‘; am Ende geht es für ihn und<br />
die Zuschauer darum, sich mit den vermeintlich Anderen zu identifizieren<br />
und gemeinsam der Vernichtung zu entkommen. Wenn Deckard im Direc-<br />
tor’s Cut beim Anblick des Origamo-Einhorns vor seiner Wohnung reali-<br />
siert, dass man seine Träume kennt und ihn daher <strong>wie</strong> jeden anderen<br />
<strong>Replikanten</strong>, der nur über implantierte Erinnerungen verfügt, behandeln<br />
wird, hat der Zuschauer mit ihm in der Vorstellung, also psychosemiotisch,<br />
die Schwelle überschritten, die den Menschen von der Maschine<br />
trennt. Indem der Film die Anthropologie, derzufolge nur Menschen,<br />
aber keine Maschinen Empathie empfinden, dekonstruiert, als Ideologie<br />
entlarvt und invertiert, gewinnt er dem melodramatischen Geschehen somit<br />
eine philosophische Pointe ab. Dass dies im Rahmen einer Science Fiction<br />
geschieht, ist kein Einwand, zumal wenn man bedenkt, dass auch die<br />
Begründung dieser Anthropologie nur im Rahmen eines Gedankenexperiments<br />
gelang, das deutlich fiktionale Züge trägt.<br />
Nachzulesen ist dieses Gedankenexperiment bei René Descartes (1596-<br />
1650), in den MEDITATIONEN ÜBER DIE GRUNDLAGEN DER PHILOSOPHIE aus dem<br />
Jahre 1629. In seinem 1637 erstmals veröffentlichten DISCOURS DE LA<br />
MÉTHODE rekapituliert Descartes das Gedankenexperiment aus den MEDITA-<br />
TIONEN noch einmal und schreibt rückblickend: „Endlich erwog ich, daß uns<br />
genau die gleichen Vorstellungen, die wir im Wachen haben, auch im<br />
Schlafe kommen können, ohne daß in diesem Fall eine davon wahr wäre,<br />
und entschloß mich daher zu der Fiktion (Kursivierung MB), daß nichts,<br />
was mir jemals in den Kopf gekommen, wahrer wäre als die Trugbilder<br />
meiner Träume.“ 25 Nur innerhalb dieses Verständnisrahmens kann Descartes<br />
an seine Behauptung aus den MEDITATIONEN anknüpfen: „Körper,<br />
Gestalt, Ausdehnung, Bewegung und Ort sind nichts als Chimären“. 26 Und<br />
allein unter dieser offenbar kontrafaktischen Voraussetzung gelingt es<br />
ihm, sein Gedankenexperiment auf das berühmte „cogito ergo sum“ zuzuspitzen:<br />
„Alsbald aber fiel mir auf, daß, während ich auf diese Weise zu<br />
denken versuchte, alles sei falsch, doch notwendig ich, der es dachte, etwas<br />
sei. Und indem ich erkannte, daß diese Wahrheit: ‚ich denke, also bin<br />
ich‘ so fest und sicher ist, daß die ausgefallensten Unterstellungen der<br />
Skeptiker sie nicht zu erschüttern vermöchten, so entschied ich (Kursivierung<br />
MB), daß ich sie ohne Bedenken als ersten Grundsatz der Philoso-<br />
25<br />
René Descartes, Von der Methode des richtigen Vernunftgebrauchs und der wissenschaftlichen Forschung. In:<br />
René Descartes: Philosophische Schriften in einem Band. Hamburg 1996, S. 53.<br />
26<br />
René Descartes: Meditationen über die Grundlagen der Philosophie. In: Descartes, Philosophische Schriften,<br />
S. 43.<br />
16