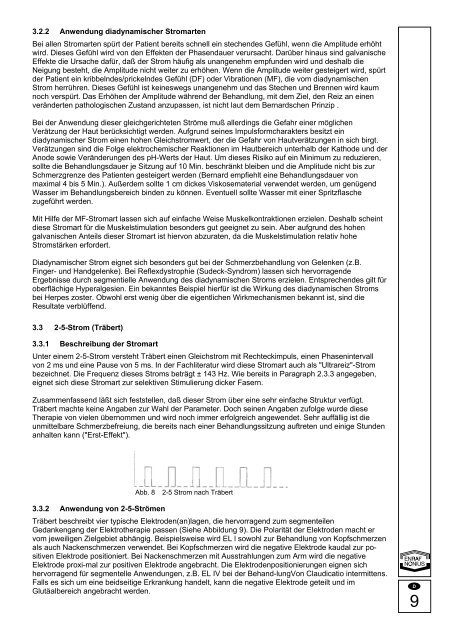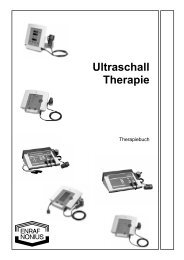und mittelfrequente Elektrotherapie - Medizintechnik Schlechte
und mittelfrequente Elektrotherapie - Medizintechnik Schlechte
und mittelfrequente Elektrotherapie - Medizintechnik Schlechte
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3.2.2 Anwendung diadynamischer Stromarten<br />
Bei allen Stromarten spürt der Patient bereits schnell ein stechendes Gefühl, wenn die Amplitude erhöht<br />
wird. Dieses Gefühl wird von den Effekten der Phasendauer verursacht. Darüber hinaus sind galvanische<br />
Effekte die Ursache dafür, daß der Strom häufig als unangenehm empf<strong>und</strong>en wird <strong>und</strong> deshalb die<br />
Neigung besteht, die Amplitude nicht weiter zu erhöhen. Wenn die Amplitude weiter gesteigert wird, spürt<br />
der Patient ein kribbelndes/prickelndes Gefühl (DF) oder Vibrationen (MF), die vom diadynamischen<br />
Strom herrühren. Dieses Gefühl ist keineswegs unangenehm <strong>und</strong> das Stechen <strong>und</strong> Brennen wird kaum<br />
noch verspürt. Das Erhöhen der Amplitude während der Behandlung, mit dem Ziel, den Reiz an einen<br />
veränderten pathologischen Zustand anzupassen, ist nicht laut dem Bernardschen Prinzip .<br />
Bei der Anwendung dieser gleichgerichteten Ströme muß allerdings die Gefahr einer möglichen<br />
Verätzung der Haut berücksichtigt werden. Aufgr<strong>und</strong> seines Impulsformcharakters besitzt ein<br />
diadynamischer Strom einen hohen Gleichstromwert, der die Gefahr von Hautverätzungen in sich birgt.<br />
Verätzungen sind die Folge elektrochemischer Reaktionen im Hautbereich unterhalb der Kathode <strong>und</strong> der<br />
Anode sowie Veränderungen des pH-Werts der Haut. Um dieses Risiko auf ein Minimum zu reduzieren,<br />
sollte die Behandlungsdauer je Sitzung auf 10 Min. beschränkt bleiben <strong>und</strong> die Amplitude nicht bis zur<br />
Schmerzgrenze des Patienten gesteigert werden (Bernard empfiehlt eine Behandlungsdauer von<br />
maximal 4 bis 5 Min.). Außerdem sollte 1 cm dickes Viskosematerial verwendet werden, um genügend<br />
Wasser im Behandlungsbereich binden zu können. Eventuell sollte Wasser mit einer Spritzflasche<br />
zugeführt werden.<br />
Mit Hilfe der MF-Stromart lassen sich auf einfache Weise Muskelkontraktionen erzielen. Deshalb scheint<br />
diese Stromart für die Muskelstimulation besonders gut geeignet zu sein. Aber aufgr<strong>und</strong> des hohen<br />
galvanischen Anteils dieser Stromart ist hiervon abzuraten, da die Muskelstimulation relativ hohe<br />
Stromstärken erfordert.<br />
Diadynamischer Strom eignet sich besonders gut bei der Schmerzbehandlung von Gelenken (z.B.<br />
Finger- <strong>und</strong> Handgelenke). Bei Reflexdystrophie (Sudeck-Syndrom) lassen sich hervorragende<br />
Ergebnisse durch segmentielle Anwendung des diadynamischen Stroms erzielen. Entsprechendes gilt für<br />
oberflächige Hyperalgesien. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist die Wirkung des diadynamischen Stroms<br />
bei Herpes zoster. Obwohl erst wenig über die eigentlichen Wirkmechanismen bekannt ist, sind die<br />
Resultate verblüffend.<br />
3.3 2-5-Strom (Träbert)<br />
3.3.1 Beschreibung der Stromart<br />
Unter einem 2-5-Strom versteht Träbert einen Gleichstrom mit Rechteckimpuls, einen Phasenintervall<br />
von 2 ms <strong>und</strong> eine Pause von 5 ms. In der Fachliteratur wird diese Stromart auch als "Ultrareiz"-Strom<br />
bezeichnet. Die Frequenz dieses Stroms beträgt ± 143 Hz. Wie bereits in Paragraph 2.3.3 angegeben,<br />
eignet sich diese Stromart zur selektiven Stimulierung dicker Fasern.<br />
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß dieser Strom über eine sehr einfache Struktur verfügt.<br />
Träbert machte keine Angaben zur Wahl der Parameter. Doch seinen Angaben zufolge wurde diese<br />
Therapie von vielen übernommen <strong>und</strong> wird noch immer erfolgreich angewendet. Sehr auffällig ist die<br />
unmittelbare Schmerzbefreiung, die bereits nach einer Behandlungssitzung auftreten <strong>und</strong> einige St<strong>und</strong>en<br />
anhalten kann ("Erst-Effekt").<br />
Abb. 8 2-5 Strom nach Träbert<br />
3.3.2 Anwendung von 2-5-Strömen<br />
Träbert beschreibt vier typische Elektroden(an)lagen, die hervorragend zum segmenteilen<br />
Gedankengang der <strong>Elektrotherapie</strong> passen (Siehe Abbildung 9). Die Polarität der Elektroden macht er<br />
vom jeweiligen Zielgebiet abhängig. Beispielsweise wird EL l sowohl zur Behandlung von Kopfschmerzen<br />
als auch Nackenschmerzen verwendet. Bei Kopfschmerzen wird die negative Elektrode kaudal zur positiven<br />
Elektrode positioniert. Bei Nackenschmerzen mit Ausstrahlungen zum Arm wird die negative<br />
Elektrode proxi-mal zur positiven Elektrode angebracht. Die Elektrodenpositionierungen eignen sich<br />
hervorragend für segmentelle Anwendungen, z.B. EL IV bei der Behand-lungVon Claudicatio intermittens.<br />
Falls es sich um eine beidseitige Erkrankung handelt, kann die negative Elektrode geteilt <strong>und</strong> im<br />
Glutäalbereich angebracht werden.<br />
D<br />
9