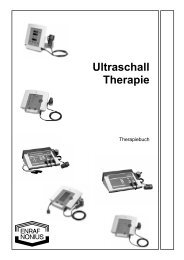und mittelfrequente Elektrotherapie - Medizintechnik Schlechte
und mittelfrequente Elektrotherapie - Medizintechnik Schlechte
und mittelfrequente Elektrotherapie - Medizintechnik Schlechte
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
der zur Kontraktion der W<strong>und</strong>oberfläche führt. Man kann also annehmen, daß das SP einen geweberegenerierenden<br />
Einfluß hat. Allem Anschein nach kommt es bei einem gestörten W<strong>und</strong>heilungsprozeß zu<br />
keiner SP-Aus-schüttung.<br />
Die Elektrostimulation beeinflußt den gestörten W<strong>und</strong>heilungsprozeß auf zwei Arten:<br />
1. Die Elektrostimulation führt zu antidromer Reizung der sensorischen Nerven, die dadurch zur<br />
Freisetzung von "Substance-P" an ihren peripheren Enden angeregt werden (Siehe Abb. 27);<br />
2. Elektrischer Strom beeinflußt das Gefäßbett im W<strong>und</strong>boden. Durch sog. "sprouting" der<br />
Kapillargefäße im W<strong>und</strong>boden wird das Granulationsgewebe ausreichend mit Nährstoffen<br />
versorgt, was wiederum das Wachsen des Granultionsgewebes fördert.<br />
8.3 W<strong>und</strong>heilung in der Praxis<br />
Sowohl MF Gleichstrom als auch <strong>mittelfrequente</strong> TENS-artige Stromarten haben eine günstigen Wirkung<br />
auf die W<strong>und</strong>heilung.<br />
8.3.1 MF Gleichstrom<br />
Bei der Gleichstrombehandlung wird eine niedrige Amplitude<br />
von 0,1 mA/cm 2 eingestellt.<br />
Nachfolgend einige Anmerkungen bezüglich der Polarität:<br />
• die Haut ist von Natur aus negativ geladen. Bei Hautverletzungen trägt das beschädigte Gebiet<br />
eine relativ positive Ladung gegenüber seiner nicht beschädigten Umgebung;<br />
• die Verwendung einer Anode auf/in der W<strong>und</strong>e fördert das Einwachsen des<br />
Granulationsgewebes, verschlimmert aber gleichzeitig eine eventuell vorhandene bakterielle<br />
Infektion;<br />
• die Verwendung einer Kathode in/auf der W<strong>und</strong>e verzögert das Einwachsen des<br />
Granulationsgewebes, wirkt aber gleichzeitig einer bakteriellen Infektion deutlich entgegen.<br />
Die folgenden Regeln sollten aufgr<strong>und</strong> obiger Informationen eingehalten werden: in den ersten 3 Tagen<br />
wird die negative Elektrode auf/in unmittelbarer Nähe des Hautdefekts angebracht. Die<br />
Behandlungsdauer beträgt 2 St<strong>und</strong>en <strong>und</strong> wird 2-6 Mal täglich durchgeführt. Nach drei Tagen wird auf/in<br />
unmittelbarer Nähe der aseptischen W<strong>und</strong>e eine positive Elektrode angebracht. Für die Behandlung tiefer<br />
W<strong>und</strong>en gilt: eine sterile Kompresse, die mit destilliertem Wasser oder einer physiologischen Salzlösung<br />
getrankt wurde, wird auf die W<strong>und</strong>e gelegt <strong>und</strong> darauf die aktive Elektrode angebracht. Die inaktive<br />
Elektrode sollte circa 25 cm proximal zum Hautdefekt angebracht werden. Für einen (nicht<br />
unterbrochenen) Gleichstrom wird eine Amplitude von 0,2-0,8 mA eingestellt.<br />
Um die Resultate der Behandlung(en) (objektiv) beurteilen zu können, wird empfohlen:<br />
• die W<strong>und</strong>oberfläche zu messen;<br />
• die Tiefe der W<strong>und</strong>e zu bestimmen;<br />
• bei Anwesenheit von Mikroorganismen in der W<strong>und</strong>e die Art dieser Mikroorganismen zu<br />
bestimmen;<br />
• jedes andere Merkmal der W<strong>und</strong>e zu beschreiben;<br />
• die W<strong>und</strong>e zu photographieren (vor Beginn der Elektrosti-mulation <strong>und</strong> danach einmal pro<br />
Woche);<br />
• die Ergebnisse nach jeder Behandlung zu notieren.<br />
8.3.2 TENS-Stromarten<br />
Auch TENS-Stromarten lassen sich zur W<strong>und</strong>heilung einsetzen 12 ' 201 . (Siehe auch Abb. 21). L<strong>und</strong>eberg [20 '<br />
verwendete bei der Behandlung von Ulzera, postoperativen W<strong>und</strong>en (Hautlappenoperation) <strong>und</strong><br />
diabetischen Ulcus cruris einen alternierenden Rechteckimpuls mit einer variablen Phasendauer von 0,2-<br />
1,0 ms.<br />
Für die erste Behandlung einer diabetischen, arteriellen <strong>und</strong> venösen Ulcera wird eine Phasendauer von<br />
1,0 ms <strong>und</strong> einer Frequenz von 80 Hz eingestellt. Die Amplitude sollte ein stark stechendes/kribbelndes<br />
Gefühl hervorrufen (sensorisch - bis an das motorische Reizniveau). Wenn dies für den Patienten zu<br />
schmerzhaft ist oder eine starke Hautirritation auslöst, kann die Phasendauer auf 0,2 ms verkürzt werden.<br />
Da mit einem symmetrisch alternierenden Strom gearbeitet wird, spielt die Polarität in diesem Fall keine<br />
Rolle. Die Elektroden werden folgendermaßen angebracht:<br />
a. wenn die Sensibilität im W<strong>und</strong>bereich intakt ist: eine Elektrode proximal <strong>und</strong> eine<br />
Elektrode distal zur W<strong>und</strong>e, <strong>und</strong> zwar möglichst dicht am W<strong>und</strong>rand;<br />
b. bei einer gestörten Sensibilität im W<strong>und</strong>bereich werden beide Elektroden proximal zur<br />
W<strong>und</strong>e angebracht, <strong>und</strong> zwar dort, wo die Sensibilität noch intakt ist.<br />
D<br />
29