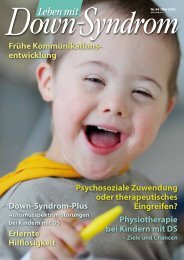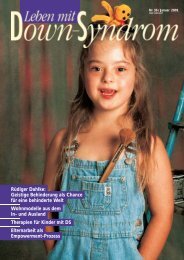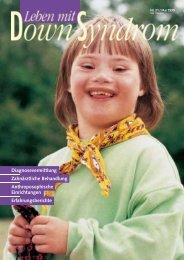Nr. 34, Mai - DS-InfoCenter
Nr. 34, Mai - DS-InfoCenter
Nr. 34, Mai - DS-InfoCenter
- TAGS
- www.ds-infocenter.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
P S Y C H O L O G I E<br />
Neue Aspekte der schulischen Förderung<br />
bei Kindern mit Down-Syndrom<br />
Werner Dittmann<br />
Zusammenfassung des Workshops “Neue Aspekte der<br />
schulischen Förderung“ von Prof. Dittmann bei der<br />
Fachtagung “Perspektiven für Menschen mit Down-<br />
Syndrom“, die vom 1. bis 3. Oktober 1999 an der Ruhr-<br />
Universität Bochum stattfand.<br />
B<br />
ei Kindern mit Down-Syndrom müssen<br />
Eltern und Professionelle leider<br />
davon ausgehen, dass diese während<br />
ihres gesamten Lebens signifikante<br />
Lernschwierigkeiten haben. Die chromosomale<br />
Ausstattung der Kinder mit<br />
Down-Syndrom birgt im Rahmen ihrer<br />
persönlichen Entwicklung neben funktionalen<br />
und motorischen Beeinträchtigungen<br />
auch eine Vielzahl von kognitiven<br />
und kommunikativen Problemen<br />
ebenso wie gesundheitliche Risiken.<br />
Jegliches Lernen ist daher für die<br />
Schüler/innen mit Down-Syndrom im<br />
Vergleich zu nicht behinderten Schülern/innen<br />
erschwerter und problembehafteter.<br />
Trotz dieser das Lernen beeinträchtigenden<br />
Bedingungen dürfen<br />
Eltern von der Gewissheit ausgehen,<br />
dass in der Regel Menschen mit Down-<br />
Syndrom viele lebensbedeutsame Fertigkeiten<br />
und Kenntnisse für ihre aktuelle<br />
und zukünftige Lebensbewältigung<br />
lernen können, wie dies z.B. ESPINÀS<br />
(1988, 21) über seine Tochter Olga formuliert:<br />
“Viele Dinge, die wir auf dem<br />
üblichen schulischen Wege dich zu lehren<br />
versucht haben, hast du nicht gelernt;<br />
aber du hast dir dein Gepäck zusammengestellt,<br />
ein unregelmäßiges,<br />
aber ein nützliches.”<br />
Dies gilt umso mehr, je optimaler der<br />
besuchte Schultyp dem individuellen<br />
Lernbedarf des Schülers/der Schülerin<br />
mit Down-Syndrom gerecht wird (SELI-<br />
KOWITZ 1997, 129).<br />
Vor diesem Hintergrund sind daher<br />
zunächst die Lernbedürfnisse der Schüler/innen<br />
mit Down-Syndrom differenziert<br />
abzuklären, die zur individuellen<br />
Lebensbewältigung erforderlich sind.<br />
10 Leben mit Down-Syndrom <strong>Nr</strong>. <strong>34</strong>, <strong>Mai</strong> 2000<br />
Erst dann ist nach jenem Schultyp zu<br />
fragen, in dem diese Lernbedürfnisse<br />
optimal gesichert werden können. Eine<br />
Vorab-Entscheidung, ob eine geeignete<br />
Schule eine so genannte “reguläre”<br />
Schule oder eine “Sonderschule” ist,<br />
muss, wie BEVERIDGE (1996, 210) betont,<br />
nachrangig sein.<br />
Um den Anteil der nur bedingt oder<br />
nicht erwerbbaren Wissensinhalte und<br />
Kompetenzbereiche des Lebens möglichst<br />
gering zu halten, worauf ebenfalls<br />
ESPINÀS (1988) hinweist, “du bist<br />
sicher unfähig, manche Stoffe zu erlernen,<br />
die der traditionelle Schulunterricht<br />
vermittelt”, sind bei Interventionsmaßnahmen<br />
(Lernen) als “Lernproblem-Variablen”<br />
die verschiedenen ätiologiespezifischen<br />
Konditionen, die individuellen<br />
Fähigkeiten und auch das<br />
soziokulturelle Umfeld mit zu berücksichtigen.<br />
Entwicklung verläuft langsamer<br />
Über viele Jahrzehnte hinweg ging man<br />
in Fachkreisen davon aus, dass bei Menschen<br />
mit Down-Syndrom das so genannte<br />
normative Entwicklungskonzept<br />
(SPECK 1981) angelegt werden könne.<br />
Dies besagt, dass Menschen mit geistiger<br />
Behinderung sich prinzipiell entlang<br />
der kognitiven Entwicklungsabfolge wie<br />
nicht behinderte Kinder und Jugendliche<br />
entwickeln. Ihr Entwicklungsgeschehen<br />
ist jedoch dezeleriert. Dezeleration<br />
bedeutet hier, dass Menschen mit<br />
Down-Syndrom die normativen Entwicklungsschritte<br />
zeitverzögert und in<br />
einer gleich gerichteten, homogenen Art<br />
durchschreiten. Doch liegt das erreich-<br />
te Entwicklungsendniveau im Vergleich<br />
zu nicht kognitiv behinderten Kindern<br />
auf einem niedrigeren Niveau (WIS-<br />
HART 1995, 60 f.). Auf diesem Annahmehintergrund<br />
lesen wir dann z.B. bei<br />
RAUH: “In den ersten drei Lebensjahren<br />
entspricht nach den übereinstimmenden<br />
Befunden der geistige Entwicklungsverlauf<br />
der <strong>DS</strong>-Kinder im Mittel etwas<br />
mehr als dem halben Tempo nicht<br />
behinderter Kinder. ... Im Alter von<br />
zehn Jahren befanden sich die ... Kinder<br />
auf einem durchschnittlichen geistigen<br />
Entwicklungsniveau von vier Jahren<br />
....”<br />
Das jeweils erreichte Entwicklungsniveau<br />
wird mit Hilfe von Intelligenz-<br />
Testverfahren festzustellen versucht.<br />
Die Verwendung dieser Verfahren, die<br />
Berechnungen von IAs und IQs als Maße<br />
zur quantitativen Festsetzung des intellektuellen<br />
Niveaus, ist bis in unsere Gegenwart<br />
ein allgemein anerkanntes<br />
Konzept. Mit diesen Verfahren lässt sich<br />
das Retardationsniveau bestimmen,<br />
und damit der Dezelerationsprozess<br />
entsprechend den Klassifikationsniveaus<br />
der WHO (1968) oder der AAMD<br />
(GROSSMAN, 1983) mit den Untergliederungen<br />
nach den Minderbegabungsniveaus,<br />
mild (leicht), moderate (mittel),<br />
severe (schwer) oder profound (sehr<br />
schwer) ermitteln und u.a. eine Zuordnung<br />
von Schülern/innen zu Schultypen<br />
oder Leistungskursen vornehmen.<br />
Intelligenztests dienten damit über<br />
eine lange Zeitspanne hinweg als Unterstützungssystem,<br />
um einen als insgesamt<br />
verlangsamt bewerteten Prozess<br />
der normativen Entwicklung beim<br />
Down-Syndrom sowohl quantitativ als<br />
auch qualitativ aufzuzeigen.<br />
Die festgestellte Retardierung der<br />
kognitiven Leistungen in Bezug zum Lebensalter<br />
war damit bei Menschen mit<br />
Behinderungen folgerichtig immer defizitär<br />
im Vergleich zum nicht behinderten<br />
Menschen. Mediziner, Psychologen,<br />
Pädagogen qualifizierten daher auch<br />
pauschal den ganzen Menschen mit<br />
Down-Syndrom als “mental retardiert”,