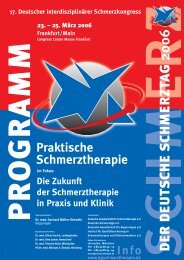Schmerztherapie 2 / 2010 - Schmerz Therapie Deutsche ...
Schmerztherapie 2 / 2010 - Schmerz Therapie Deutsche ...
Schmerztherapie 2 / 2010 - Schmerz Therapie Deutsche ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Frage war. Amüsant an der „42“ von Deep<br />
Thought ist nicht nur die falsche Tiefgründigkeit<br />
der Antwort, amüsant ist vielmehr auch<br />
die absurde Vorstellung, dass nur die Antwort<br />
und nicht der ihr zugrunde liegende Entscheidungsprozess<br />
für die Bewohner der von<br />
Adams beschriebenen Galaxis eine Rolle<br />
spielen könnte – analog zu der Tatsache, dass<br />
die Ergebnisse medizinischer Metaanalysen<br />
von Ärzten in aller Regel willfährig hingenommen<br />
werden, ohne auch nur jemals kritisch<br />
hinterfragt zu werden.<br />
Fluch oder Segen?<br />
Metaanalysen haben zum Ziel, die empirischen<br />
Befunde mehrerer voneinander unabhängiger<br />
Untersuchungen zu einer bestimmten<br />
Problemstellung zu untersuchen, um Wissenschaftler<br />
bei der Informationsintegration<br />
und Praktiker bei der Entscheidungsfindung<br />
zu unterstützen. Dementsprechend sind Metaanalysen<br />
und die auf metaanalytischen Verfahren<br />
beruhenden S3-Leitlinien – so sie korrekt<br />
erstellt, interpretiert und genutzt werden –<br />
durchaus sinnvolle und für die praktische Arbeit<br />
am Patienten hilfreiche Instrumente. Zur<br />
Qual permutieren sie erst bei fehlerhafter Erstellung<br />
(weshalb auch jede noch so hochrangig<br />
publizierte Metaanalyse kritisch gelesen<br />
werden muss), durch missbräuchliche Anwendung<br />
als pseudowissenschaftliches Instrument<br />
zur Rationalisierung ökonomisch notwendig<br />
gewordener Kostensenkungsmaßnahmen<br />
(das gegenwärtig bevorzugte Anwendungsgebiet<br />
für Metaanalysen) oder aufgrund<br />
ihrer Menge. Denn mittlerweile entwickelt sich<br />
die Zahl der weltweit publizierten Metaanalysen<br />
analog zu den Primärdaten exponentiell.<br />
Dies hat zur Folge, dass es – wie bei den Nationalen<br />
Versorgungsleitlinien in Deutschland<br />
bereits beispielhaft realisiert – erste Meta-Metaanalysen<br />
von Metaanalysen gibt.<br />
Mit der Typhusimpfung ging es los!<br />
Um Chancen wie Risiken von Metaanalysen zu<br />
verstehen, ist es sinnvoll, sich noch einmal mit<br />
ihrer Entstehungsgeschichte auseinanderzusetzen.<br />
Eine Metaanalyse ist zunächst einmal<br />
nicht mehr (aber auch nicht weniger) als eine<br />
Zusammenfassung der Ergebnisse von Primäruntersuchungen<br />
zu sog. Metadaten unter<br />
Verwendung quantitativer, statistischer Verfahren.<br />
Der Begriff Metaanalyse wurde erstmalig<br />
1976 eingeführt. Die zugehörigen methodischen<br />
Verfahren wurden aber bereits 1904<br />
von dem britischen Mathematiker Karl Pearson<br />
erstmalig angewandt, um die Teststärke (Power)<br />
von Untersuchungen mit wenigen Probanden<br />
durch Zusammenfassen zu erhöhen (womit<br />
– ganz nebenbei – das zweite sinnvolle<br />
SCHMERZTHERAPIE 2/<strong>2010</strong> (26. Jg.)<br />
Anwendungsgebiet metaanalytischer Verfahren<br />
beschrieben wurde) und letztlich zweifelsfrei<br />
zu klären, ob die damals in Großbritannien<br />
neu eingeführte Impfung gegen Typhus nun<br />
hilft oder nicht.<br />
Eminenz- vs. evidenzbasierte Medizin<br />
Der schnelle Zuwachs wissenschaftlicher Erkenntnisse<br />
in der Medizin macht es selbst für<br />
die engagiertesten Ärzte unmöglich, ihr gesamtes<br />
Fachgebiet anhand von Originalliteratur<br />
zu überblicken. Eine umfassende und ausgewogene<br />
Zusammenfassung medizinischen Wissens<br />
ist daher eine wesentliche Voraussetzung,<br />
um den aktuellen medizinischen Kenntnisstand<br />
für Patienten nutzbar zu machen. In der Vergangenheit<br />
wurde die Zusammenfassung des medizinischen<br />
Kenntnisstandes vom klassischen<br />
narrativen Review übernommen.<br />
Ein solches Review wurde in der Regel von anerkannten<br />
klinischen Autoritäten geschrieben,<br />
die in ihre Übersichtsartikel nicht selten nur diejenigen<br />
Erkenntnisse und Studien selektiv einfließen<br />
ließen, die ihrer eigenen subjektiven<br />
Sichtweise entsprachen, in aller Regel – wenn<br />
überhaupt – unzulässige statistische Verfahren<br />
zur quantitativen Integration der zitierten Studienergebnisse<br />
anwendeten und deren Schlussfolgerungen<br />
für den Leser häufig nicht oder nur<br />
mit Mühe nachvollziehbar waren. Konsekutiv<br />
entwickelten sich – in Abhängigkeit von den<br />
verschiedenen subjektiven Bewertungen wissenschaftlicher<br />
Erkenntnisse im klassischen<br />
Review – divergente klinische Schulen mit zum<br />
Teil unterschiedlichen Behandlungskonzepten<br />
für ein und dasselbe Krankheitsbild (sog. eminenzbasierte<br />
Medizin).<br />
Im Rahmen der Bemühungen, den klassischen<br />
narrativen Review durch objektivere<br />
und für den Leser quantitativ nachvollziehbarere<br />
Methoden zu ersetzen, kommt Metaanalysen<br />
eine zentrale Rolle zu. Diese haben<br />
zum Ziel, die Ergebnisse unabhängiger Studien<br />
zum gleichen Thema quantitativ zu integrieren.<br />
Im Gegensatz zum klassischen Review sollten<br />
Biometrie<br />
sie sämtliche Studien berücksichtigen, die klar<br />
definierte Einschlusskriterien erfüllen und nicht<br />
nur die, die der Intention des Autors entsprechen<br />
– womit die Grundlagen der evidenzbasierten<br />
Medizin gelegt wurden (Tab. 1).<br />
Das Prinzip der Metaanalyse<br />
Die Durchführung einer Metaanalyse lässt sich<br />
vereinfacht auch mit anderen bekannten Untersuchungsformen<br />
der empirischen Forschung<br />
vergleichen wie beispielsweise mit der Befragung<br />
von Personen. Bei der Metaanalyse stellen<br />
jedoch eine Studie bzw. die Untersuchungsergebnisse<br />
dieser Studie die Untersuchungsobjekte<br />
dar. Diese werden durch instruierte<br />
Codierungsspezialisten hinsichtlich relevanter<br />
Eigenschaften „interviewt“ und die ermittelten<br />
Ergebnisse dann anhand definierter biometrischer<br />
Methoden analysiert. Eine metaanalytische<br />
Untersuchung operiert also nach<br />
ähnlichen Prinzipien wie die Primäruntersuchungen,<br />
auf deren Untersuchungsergebnissen<br />
sie aufbaut. Aus diesem Grund sind auch<br />
die Vorgehensweise und der Ablauf einer Metaanalyse<br />
mit der Vorgehensweise von Einzeluntersuchungen<br />
vergleichbar: Auch hier wird ein<br />
Problem formuliert, werden Daten gesammelt,<br />
codiert, bewertet, analysiert und schließlich<br />
präsentiert und interpretiert.<br />
Komplexe Prozeduren ersparen nicht<br />
kritisches Lesen!<br />
Das <strong>Deutsche</strong> Cochrane Zentrum definiert Metaanalysen<br />
als statistische Verfahren mit dem<br />
Ziel, die Ergebnisse mehrerer Studien zu einer<br />
identischen Fragestellung zu einem Gesamtergebnis<br />
zusammenzufassen, um auf diese Weise<br />
die Aussagekraft (Power) bzw. die Genauigkeit<br />
der Effekteinschätzung im Vergleich zu den<br />
Einzelstudien maximal zu erhöhen. Dementsprechend<br />
wird Metaanalysen – insbesondere<br />
wenn es um die Erforschung und Bewertung<br />
medizinischer <strong>Therapie</strong>verfahren geht – eine<br />
sehr hohe Aussagekraft unterstellt. Dabei wird<br />
jedoch außer Acht gelassen, dass sie sich –<br />
Tab. 1: Unterschiede zwischen dem klassischen narrativen Review und der<br />
Metaanalyse hinsichtlich der Zusammenfassung medizinischen Wissens<br />
Klassischer narrativer Review Metaanalyse<br />
I.d.R. geschrieben von klinischen Autoritäten Kann auch von „Nichtklinikern“ geschrieben werden<br />
Selektiver Einschluss von Studien, die den Klare Definition der Einschlusskriterien, (mehr oder<br />
Autor (und seine Aussagen) unterstützen weniger) objektiver Einschluss<br />
Oft unklar, wie Schlussfolgerungen aus den Ableitung der Schlussfolgerungen aus den Daten ist<br />
Daten abgeleitet werden formal nachvollziehbar<br />
Keine oder inkorrekte Methoden der Reproduzierbare, statistisch nachvollziehbare<br />
Datenintegration Datenintegration<br />
Fördert „Schulen“ mit divergenter Zielt auf eine einheitliche, „evidenzbasierte“<br />
Behandlungspraxis Behandlungspraxis<br />
15