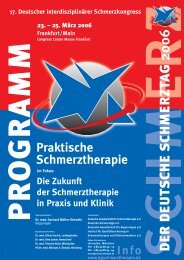Schmerztherapie 2 / 2010 - Schmerz Therapie Deutsche ...
Schmerztherapie 2 / 2010 - Schmerz Therapie Deutsche ...
Schmerztherapie 2 / 2010 - Schmerz Therapie Deutsche ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
nale <strong>Schmerz</strong>en nach einer Nervenläsion in einer<br />
sonst gefühllosen Körperregion bezeichnet<br />
man als Anaesthesia dolorosa, spontan auftretende<br />
oder provozierte unangenehme und<br />
abnorme Empfindungen als Dysästhesie. Eine<br />
allgemein herabgesetzte Empfindungsstärke<br />
ist eine Hypästhesie, eine verstärkte Empfindung<br />
auf schmerzhafte und nicht schmerzhafte<br />
Reize eine Hyperästhesie. Hypalgesie ist eine<br />
allgemein herabgesetzte, Hyperalgesie eine<br />
verstärkte <strong>Schmerz</strong>empfindung. Hyperpathie<br />
ist eine verstärkte Reaktion auf einen schmerzhaften<br />
oder nicht schmerzhaften Reiz besonders<br />
als Antwort auf wiederholte Reize, und<br />
Parästhesie bezeichnet eine abnorme Gefühlssensation<br />
ohne unangenehmen Charakter.<br />
Zusätzlich zu den sensorischen Veränderungen<br />
können Veränderungen im autonomen<br />
Nervensystem zu Durchblutungsstörungen<br />
und trophischen Störungen führen. Die Motorik<br />
kann ebenfalls beeinträchtigt sein.<br />
Genese<br />
Werden nozizeptive Neurone geschädigt, erhöht<br />
dies die Spontanaktivität. Die Schwelle für<br />
die Reizweiterleitung sinkt bei gleichzeitig gesteigerter<br />
Reizantwort. Natrium- und Kalziumkanäle,<br />
aber auch Capsacainrezeptoren sind<br />
an diesem Prozess beteiligt. Wird das sympathische<br />
Nervensystem durch Neubildung noradrenerger<br />
Rezeptoren einbezogen, wird die<br />
zentrale Sensibilisierung und somit die Chronifizierung<br />
verstärkt. Zentrale Neurone reagieren<br />
auf eine anhaltende Aktivität nozizeptiver Neurone<br />
im Sinne eines Wind-up mit einer verstärkten<br />
Reizantwort bei oft gleichzeitiger Abnahme<br />
der <strong>Schmerz</strong>hemmung.<br />
Allen Störungen gemeinsam ist zwar die<br />
Schädigung nervaler Strukturen, hinter denen<br />
sich allerdings die unterschiedlichsten pathophysiologischen<br />
Veränderungen auf neuronaler und<br />
molekulärer Basis verbergen (Tab. 1, Abb. 1).<br />
Diagnose<br />
Anamnese und Untersuchung weisen den Weg.<br />
Der <strong>Deutsche</strong> <strong>Schmerz</strong>fragebogen sowie die<br />
<strong>Schmerz</strong>tagebücher sind wichtige Dokumentationsmittel.<br />
Hinweise liefern auch bestehende<br />
Erkrankungen, die mit einer Neuropathie einhergehen<br />
können. Auch <strong>Schmerz</strong>qualität, <strong>Schmerz</strong>dauer<br />
und Lokalisation geben Anhaltspunkte.<br />
Wichtige Merkmale sind typische sensorische<br />
und motorische Störungen sowie solche des<br />
autonomen Nervensystems. Die Untersuchung<br />
sollte das Bestreichen mit Pinsel oder Watteträgern,<br />
den Fingerdruck, die Berührung mit Pin-<br />
Prick oder einer Akupunkturnadel, die Berührung<br />
mit kalten sowie mit warmen Gegenständen<br />
beinhalten. Diagnostische Sympathikusblockaden<br />
zeigen den Anteil der sympathischen<br />
SCHMERZTHERAPIE 2/<strong>2010</strong> (26. Jg.)<br />
Aktivität an der gesamten <strong>Schmerz</strong>erkrankung.<br />
Laboruntersuchungen (z.B. Blutzuckerwerte,<br />
Borrelientiter, Entzündungsparameter etc.) und<br />
elektrophysiologische Untersuchungen (Nervenleitgeschwindigkeit,<br />
Elektromyogramm, somatosensorisch<br />
evozierte Potenziale) können<br />
weitere Diagnostikbestandteile sein, wie auch<br />
bildgebende Verfahren oder weitergehende Untersuchungsmethoden.<br />
<strong>Therapie</strong><br />
Liegt eine Grunderkrankung vor, ist diese zu<br />
behandeln. Bei einem Diabetes mellitus sollte<br />
A<br />
Zertifizierte Fortbildung<br />
eine stabile Stoffwechselsituation angestrebt<br />
werden. Engpässe sollten, wenn möglich, beseitigt<br />
werden. Die <strong>Schmerz</strong>symptomatik führt<br />
zur Auswahl des für die individuelle Situation<br />
am ehesten wirksamen Medikamentes (Abb. 2).<br />
Retardpräparate sind für das ideale Verhältnis<br />
von Wirkung und Nebenwirkung günstiger. Die<br />
Wirksamkeit lässt sich erst nach zwei bis vier<br />
Wochen beurteilen. Darüber ist der Patient zu<br />
informieren. Ist die Wirkung einer Monotherapie<br />
nicht ausreichend, können Kombinationstherapien<br />
mit niedrigen Tagesdosen sinnvoll<br />
werden. Wichtig ist die Einbeziehung und Auf-<br />
B C<br />
D<br />
<strong>Schmerz</strong> <strong>Schmerz</strong> <strong>Schmerz</strong><br />
C A C A/Aδ C A<br />
C<br />
Mod. nach Baron Abb. 1: Entstehungsmechanismen neuropathischer <strong>Schmerz</strong>en<br />
Das Oval stellt das Rückenmark dar.<br />
A: Normale Verhältnisse. Zentrale Projektionen unmyelinisierter C-Afferenzen enden im<br />
Hinterhorn und werden hier auf sekundäre nozizeptive Neurone umgeschaltet. A-Berührungsafferenzen<br />
projizieren beim Menschen ohne Umschaltung in die Hinterstränge (nicht<br />
eingezeichnet) und enden ebenfalls an afferenten Hinterhornneuronen.<br />
B: Periphere Sensibilisierung und zentrale Sensibilisierung. Partiell geschädigte primär afferente<br />
C-Nozizeptoren können ektope Nervenimpulse generieren oder chronisch sensibilisiert<br />
werden (Stern an der C-Faser). Diese pathologische Ruheaktivität in afferenten C-Nozizeptoren<br />
führt zu einer zentralen Sensibilisierung der sekundären afferenten Hinterhornneurone<br />
(Stern, zentral) und so zu einer Umwandlung der funktionell wirksamen synaptischen Strukturen<br />
im Hinterhorn. Dadurch können Impulse aus niederschwelligen A- und Aδ-Berührungsafferenzen<br />
jetzt zentrale nozizeptive Neurone aktivieren.<br />
C: Synaptische Reorganisation im zentralen Nervensystem infolge Degeneration primär afferenter<br />
C-Nozizeptoren. Periphere Nervenläsionen können unter besonderen Umständen auch<br />
einen erheblichen Untergang an C-Faser-Neuronen verursachen. Dementsprechend sind die<br />
synaptischen Kontakte an zentralen nozizeptiven Neuronen des Hinterhorns reduziert. Zentrale<br />
Endigungen noch intakter dicker myelinisierter Fasern können daraufhin auswachsen<br />
und neue synaptische Kontakte mit den nunmehr „freien“ zentralen nozizeptiven Neuronen<br />
ausbilden. Dadurch können ebenfalls Impulse aus niederschwelligen A-Berührungsafferenzen<br />
zentrale nozizeptive Neurone aktivieren.<br />
D: Degeneration hemmender Neuronensysteme. Absteigende Bahnen aus dem Hirnstamm<br />
(z.B. aus dem periaquäduktalen Grau) hemmen mit den Transmittern Noradrenalin und<br />
Serotonin die Aktivität in nozizeptiven Hinterhornneuronen. GABAerge Interneurone üben<br />
eine tonische Inhibition im Hinterhorn aus. Chronische nozizeptive Aktivität kann einen<br />
Funktionsverlust und sogar eine Degeneration dieser inhibitorischen Systeme bewirken,<br />
was zu einer unbeeinträchtigten Transmission nozieptiver Impulse führt.<br />
19