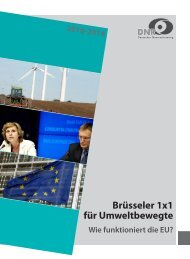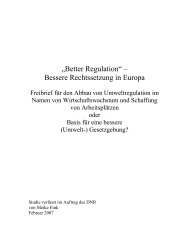Nachhaltiges Europa Abschlusspublikation - Global Marshall Plan
Nachhaltiges Europa Abschlusspublikation - Global Marshall Plan
Nachhaltiges Europa Abschlusspublikation - Global Marshall Plan
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Nachhaltiges</strong> <strong>Europa</strong><br />
54<br />
Das bedeutet, dass „Cash“ in die Taschen der<br />
Armen fließen muss, und für die meisten länd-<br />
lichen Bevölkerungsgruppen wird der Handel mit<br />
eigenen Agrarprodukten die einzige Gelegenheit<br />
dazu bieten. Immer stellt sich für sie dabei eine<br />
Wettbewerbssituation, ob sie nur für den lokalen,<br />
oder sogar auch für den nationalen oder internati-<br />
onalen Markt produzieren. Je näher aber ein<br />
Marktplatz liegt, desto homogener die Mitkonkurrenten,<br />
desto weniger schlagen Transport, Lagerung,<br />
Haltbarmachung oder auch Qualitätsunter-<br />
schiede zu Buche. Auch wenn die Anbieter auf örtlichen<br />
Bauernmärkten nicht alle gleich günstige<br />
Produktions- und Vermarktungsbedingungen vor-<br />
weisen, so orientieren sich doch die größeren Betriebe<br />
mit höherem Potential in der Regel auf<br />
lukrative regionale, nationale und internationale<br />
Märkte. Zwischenhändler spielen im kleinräumlichen<br />
Handel eine untergeordnete Rolle und die<br />
Nachfrage konzentriert sich vorwiegend auf lokal<br />
herstellbare Güter. Das ist ein Metier, in dem auch<br />
die arme Bevölkerung eine Chance sieht. Handel<br />
hat es schon seit Jahrtausenden und wohl überall<br />
gegeben und ein gewisses Maß an Wettbewerb<br />
dürfte dabei seit eh und je den Umfang und Erfolg<br />
von Vermarktungsaktivitäten bestimmt haben.<br />
Welche Beispiele aber gibt es dafür, dass Handel<br />
und Wettbewerb primär den Schwächeren genützt<br />
und soziale Unterschiede in Agrargesellschaften<br />
abgebaut hätten?<br />
Wettbewerb<br />
Für die Verfechter eines neo-liberalen Wirtschaftsmodells<br />
dient der Wettbewerb dazu, eine<br />
optimale Ressourcenallokation zu erhalten. Nicht-<br />
profitable Standorte werden dadurch aus der Produktion<br />
verdrängt, die sich anderenfalls nur mittels<br />
überhöhter Konsumentenpreise, staatlicher<br />
Subventionen und künstlicher Abschottung von<br />
Konkurrenten behaupten können. Der Staat sollte<br />
sich weitgehend regulativer Eingriffe enthalten.<br />
Damit werden, so die Theorie, der Gesellschaft<br />
Kosten erspart und Wohlstandsgewinne erzielt, die<br />
letzten Endes auch einer Armutsbekämpfung zugute<br />
kommen. Aus Gründen des Wettbewerbs<br />
freigesetzte Arbeitsplätze müssen in anderen,<br />
wirtschaftlich konkurrenzfähigeren Sektoren Verwendung<br />
finden. Gibt es solche Sektoren nicht,<br />
bleibt es der Gesellschaft, mildtätigen sozialen Einrichtungen<br />
oder traditionellen Selbsthilfegruppen<br />
überlassen, sich um die Opfer dieses Wirtschafts-<br />
modells zu kümmern. Die dafür entstehenden<br />
Kosten belasten jedenfalls nicht mehr die Jahresbilanzen<br />
der Unternehmen.<br />
Lange Zeit beschworen die Freihandelsapologeten<br />
sog. „Trickle down-Effekte“. Dabei wurden die<br />
wirtschaftlich Potenten unterstützt in der Hoff-<br />
nung, dass längerfristig auch positive Auswirkun-<br />
gen auf die Armen durchsickern würden. Leider<br />
blieben diese Effekte bis heute eher Illusion als<br />
Wirklichkeit. Trotzdem feiern sie in neo-liberalen<br />
Armutsbekämpfungsstrategien fröhliche Urstände.<br />
Strukturanpassungsprogramme, Strategien der<br />
Entschuldung von Weltbank und internationalem<br />
Währungsfonds oder die Handelsliberalisierung im<br />
Rahmen der Welthandelsorganisation werden immer<br />
wieder als Beitrag zur Reduzierung von Not,<br />
Hunger und Armut in den Entwicklungsländern<br />
propagiert, ohne dass auch nur im geringsten ihr<br />
Nutzen für das Gros der Armen nachgewiesen<br />
worden wäre.<br />
Monopolstellung weniger Unternehmen<br />
Wettbewerb ohne Kontrolle, ohne soziale, ökologische<br />
und ökonomische Regeln führt in einer Welt<br />
ungleicher Handelspartner unweigerlich zur Verdrängung<br />
der Schwächeren durch die Stärkeren,<br />
wann immer es für die Stärkeren vorteilhaft ist. Da<br />
Wettbewerb im Prinzip zwar dem Handel und einer<br />
effizienten Ressourcennutzung dient, de fakto aber<br />
einzelnen Unternehmen ziemlich lästig werden<br />
kann, geht mit ihm stets die Versuchung einher,<br />
missliebige Mitkonkurrenten auszuschalten. Weltweit<br />
geschieht das bekanntlich in großem Stil. Die<br />
Konsequenz sind monopolistische Machtstruktu-<br />
ren, die das Gegenteil von Freihandel und Wettbewerb<br />
bedeuten. International gibt es kein Kartellrecht,<br />
das eine zu starke und handelsbedro-<br />
hende Machtzusammenballung einzelner Unternehmen<br />
und multinationaler Firmen unterbinden<br />
würde. So untergräbt der Wettbewerb seine eigene<br />
ideologische Grundlage. Heute schon ist in der<br />
Landwirtschaft eine extreme Konzentration im<br />
Agrobusiness auf wenige dominierende Unternehmen<br />
festzustellen. Wie blauäugig müssen wir sein,<br />
die Welternährung in die Hände einiger auf Rendite<br />
fixierter Manager und Aktionäre zu legen?<br />
Migration<br />
Wenn es nicht gelingt, benachteiligte, verarmte<br />
Bevölkerungsgruppen von den Segnungen eines<br />
wirtschaftlichen Wachstums profitieren zu lassen,<br />
dann werden die Armen dorthin wandern, wo sie<br />
sich ihren Teil am Wohlstand der anderen holen<br />
können. Wenn es sein muss, mit Gewalt. Die Migration<br />
in die Städte hat heute schon Ausmaße er-<br />
reicht, die manchen Stadtplanern, Sicherheitsfachleuten<br />
oder Gesundheitsexperten die Haare zu<br />
Berge stehen lassen. Manche lateinamerikanische<br />
Länder sind bereits zu über 90% verstädtert. Im<br />
Jahr 2030 wird über die Hälfte der Weltbevölkerung<br />
in urbanen Ballungszentren zuhause sein.<br />
Damit gehen nicht nur Versorgungs- und Sicherheitsprobleme<br />
einher, auch die Kosten für die Ge-