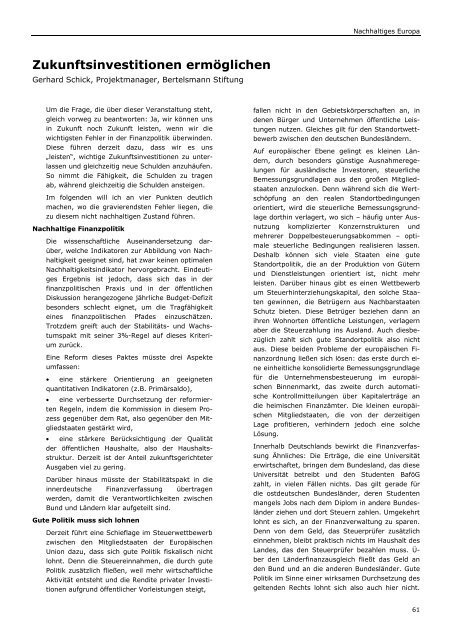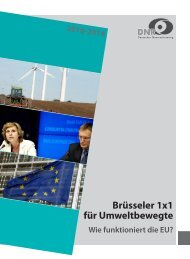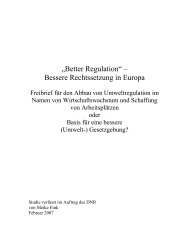Nachhaltiges Europa Abschlusspublikation - Global Marshall Plan
Nachhaltiges Europa Abschlusspublikation - Global Marshall Plan
Nachhaltiges Europa Abschlusspublikation - Global Marshall Plan
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Zukunftsinvestitionen ermöglichen<br />
Gerhard Schick, Projektmanager, Bertelsmann Stiftung<br />
Um die Frage, die über dieser Veranstaltung steht,<br />
gleich vorweg zu beantworten: Ja, wir können uns<br />
in Zukunft noch Zukunft leisten, wenn wir die<br />
wichtigsten Fehler in der Finanzpolitik überwinden.<br />
Diese führen derzeit dazu, dass wir es uns<br />
„leisten“, wichtige Zukunftsinvestitionen zu unterlassen<br />
und gleichzeitig neue Schulden anzuhäufen.<br />
So nimmt die Fähigkeit, die Schulden zu tragen<br />
ab, während gleichzeitig die Schulden ansteigen.<br />
Im folgenden will ich an vier Punkten deutlich<br />
machen, wo die gravierendsten Fehler liegen, die<br />
zu diesem nicht nachhaltigen Zustand führen.<br />
Nachhaltige Finanzpolitik<br />
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung dar-<br />
über, welche Indikatoren zur Abbildung von Nachhaltigkeit<br />
geeignet sind, hat zwar keinen optimalen<br />
Nachhaltigkeitsindikator hervorgebracht. Eindeutiges<br />
Ergebnis ist jedoch, dass sich das in der<br />
finanzpolitischen Praxis und in der öffentlichen<br />
Diskussion herangezogene jährliche Budget-Defizit<br />
besonders schlecht eignet, um die Tragfähigkeit<br />
eines finanzpolitischen Pfades einzuschätzen.<br />
Trotzdem greift auch der Stabilitäts- und Wachs-<br />
tumspakt mit seiner 3%-Regel auf dieses Kriterium<br />
zurück.<br />
Eine Reform dieses Paktes müsste drei Aspekte<br />
umfassen:<br />
• eine stärkere Orientierung an geeigneten<br />
quantitativen Indikatoren (z.B. Primärsaldo),<br />
• eine verbesserte Durchsetzung der reformier-<br />
ten Regeln, indem die Kommission in diesem Prozess<br />
gegenüber dem Rat, also gegenüber den Mit-<br />
gliedstaaten gestärkt wird,<br />
• eine stärkere Berücksichtigung der Qualität<br />
der öffentlichen Haushalte, also der Haushaltsstruktur.<br />
Derzeit ist der Anteil zukunftsgerichteter<br />
Ausgaben viel zu gering.<br />
Darüber hinaus müsste der Stabilitätspakt in die<br />
innerdeutsche Finanzverfassung übertragen<br />
werden, damit die Verantwortlichkeiten zwischen<br />
Bund und Ländern klar aufgeteilt sind.<br />
Gute Politik muss sich lohnen<br />
Derzeit führt eine Schieflage im Steuerwettbewerb<br />
zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen<br />
Union dazu, dass sich gute Politik fiskalisch nicht<br />
lohnt. Denn die Steuereinnahmen, die durch gute<br />
Politik zusätzlich fließen, weil mehr wirtschaftliche<br />
Aktivität entsteht und die Rendite privater Investitionen<br />
aufgrund öffentlicher Vorleistungen steigt,<br />
<strong>Nachhaltiges</strong> <strong>Europa</strong><br />
fallen nicht in den Gebietskörperschaften an, in<br />
denen Bürger und Unternehmen öffentliche Leis-<br />
tungen nutzen. Gleiches gilt für den Standortwettbewerb<br />
zwischen den deutschen Bundesländern.<br />
Auf europäischer Ebene gelingt es kleinen Län-<br />
dern, durch besonders günstige Ausnahmeregelungen<br />
für ausländische Investoren, steuerliche<br />
Bemessungsgrundlagen aus den großen Mitglied-<br />
staaten anzulocken. Denn während sich die Wertschöpfung<br />
an den realen Standortbedingungen<br />
orientiert, wird die steuerliche Bemessungsgrund-<br />
lage dorthin verlagert, wo sich – häufig unter Ausnutzung<br />
komplizierter Konzernstrukturen und<br />
mehrerer Doppelbesteuerungsabkommen – opti-<br />
male steuerliche Bedingungen realisieren lassen.<br />
Deshalb können sich viele Staaten eine gute<br />
Standortpolitik, die an der Produktion von Gütern<br />
und Dienstleistungen orientiert ist, nicht mehr<br />
leisten. Darüber hinaus gibt es einen Wettbewerb<br />
um Steuerhinterziehungskapital, den solche Staaten<br />
gewinnen, die Betrügern aus Nachbarstaaten<br />
Schutz bieten. Diese Betrüger beziehen dann an<br />
ihren Wohnorten öffentliche Leistungen, verlagern<br />
aber die Steuerzahlung ins Ausland. Auch diesbe-<br />
züglich zahlt sich gute Standortpolitik also nicht<br />
aus. Diese beiden Probleme der europäischen Finanzordnung<br />
ließen sich lösen: das erste durch ei-<br />
ne einheitliche konsolidierte Bemessungsgrundlage<br />
für die Unternehmensbesteuerung im europäischen<br />
Binnenmarkt, das zweite durch automatische<br />
Kontrollmitteilungen über Kapitalerträge an<br />
die heimischen Finanzämter. Die kleinen europäischen<br />
Mitgliedstaaten, die von der derzeitigen<br />
Lage profitieren, verhindern jedoch eine solche<br />
Lösung.<br />
Innerhalb Deutschlands bewirkt die Finanzverfas-<br />
sung Ähnliches: Die Erträge, die eine Universität<br />
erwirtschaftet, bringen dem Bundesland, das diese<br />
Universität betreibt und den Studenten BaföG<br />
zahlt, in vielen Fällen nichts. Das gilt gerade für<br />
die ostdeutschen Bundesländer, deren Studenten<br />
mangels Jobs nach dem Diplom in andere Bundesländer<br />
ziehen und dort Steuern zahlen. Umgekehrt<br />
lohnt es sich, an der Finanzverwaltung zu sparen.<br />
Denn von dem Geld, das Steuerprüfer zusätzlich<br />
einnehmen, bleibt praktisch nichts im Haushalt des<br />
Landes, das den Steuerprüfer bezahlen muss. Über<br />
den Länderfinanzausgleich fließt das Geld an<br />
den Bund und an die anderen Bundesländer. Gute<br />
Politik im Sinne einer wirksamen Durchsetzung des<br />
geltenden Rechts lohnt sich also auch hier nicht.<br />
61