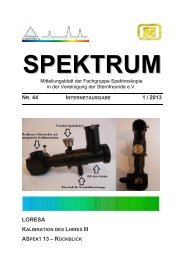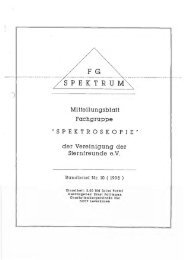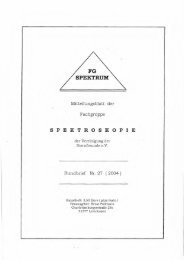Grundlagen der elementanalytischen Sternspektroskopie - FG ...
Grundlagen der elementanalytischen Sternspektroskopie - FG ...
Grundlagen der elementanalytischen Sternspektroskopie - FG ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- 71 -<br />
6. Elementanalytische <strong>Sternspektroskopie</strong> - praktische Anwendung<br />
6.1 Aufbau <strong>der</strong> Messapparatur<br />
Ziel meiner Facharbeit war es, neben dem Verstehen <strong>der</strong> theoretischen <strong>Grundlagen</strong> auch<br />
selbst Sternspektren aufzunehmen und an ihnen die theoretischen Ergebnisse nachzuprüfen.<br />
Zur Aufnahme <strong>der</strong> Spektren stand mir aufgrund meiner Tätigkeit als Amateurastronom das<br />
nötige Equipment zur Verfügung, bis auf ein Beugungsgitter, das zur Erzeugung <strong>der</strong> Spektren<br />
notwendig war. Die Funktion des Beugungsgitters ist leicht erklärt. Ebenso wie beim<br />
Doppelspaltexperiment wird Licht an Gitterfurchen gebeugt. Je mehr Furchen/Spalte ein<br />
Gitter hat, desto schärfer werden die Maxima <strong>der</strong> Wahrscheinlichkeitsverteilung und desto<br />
kleiner werden die Nebenmaxima. Das bedeutet, je mehr Furchen das Gitter hat, desto höher<br />
ist das Auflösungsvermögen. Da jede Wellenlänge von dem Gitter unter einem an<strong>der</strong>en<br />
Winkel gebeugt wird, spaltet sich das Licht in ein Spektrum auf. Der Vorteil zu einem Prisma<br />
ist wohl die gleichmäßige Skalierung <strong>der</strong> Wellenlängen, im Gegensatz zum Prisma. Das<br />
verschafft Vorteile bei <strong>der</strong> Kalibrierung <strong>der</strong> Spektren. Wenn man zwei Spektrallinien im<br />
Spektrum kennt, kann man sozusagen eichen und alle weiteren Spektrallinien stimmen<br />
automatisch. Beim Prisma ist das nicht <strong>der</strong> Fall, <strong>der</strong> Beugungswinkel hängt nicht linear von<br />
<strong>der</strong> Wellenlänge ab. Der Nachteil zum Prisma ist allerdings, dass das Licht beim Gitter in<br />
verschiedene Ordnungen gebeugt wird und so Licht verloren geht, was mit einer höheren<br />
Belichtungszeit bei <strong>der</strong> Aufnahme von Spektren kompensiert werden muss. In <strong>der</strong> 0. Ordnung<br />
wird das Licht nicht diffraktiert, dieses ist einfach verloren. Das benutzte Beugungsgitter<br />
(Transmissionsgitter), welches zum Inventar <strong>der</strong> Schulsternwarte gehört, ist von <strong>der</strong> Firma<br />
Baa<strong>der</strong> Planetarium und besitzt 207 Furchen/mm. Dies ergibt ein theoretisches Auflösungs-<br />
vermögen von 0,1nm. Das Beugungsgitter lässt sich leicht über ein Filtergewinde in Okulare,<br />
o<strong>der</strong> Aufnahmeoptiken einsetzen und wird somit in den konvergenten Strahlengang des<br />
Teleskops eingebracht. Daraus ergibt sich ein weiteres Problem: Beugungsgitter funktionieren<br />
nur dann optimal, wenn parallele Strahlen auftreffen. An<strong>der</strong>nfalls kommt es zu einer<br />
Verschmierung <strong>der</strong> Spektrallinien, da in je<strong>der</strong> Ordnung je<strong>der</strong> Lichtstrahl, <strong>der</strong> auf das<br />
Beugungsgitter schräg auftrifft, zu einer Phasenverschiebung <strong>der</strong> Beugungsmaxima je<strong>der</strong><br />
Wellenlänge beiträgt. Das reduziert in unserem Fall das Auflösungsvermögen um den nicht<br />
unerheblichen Fakor 3,5. Für Spektralklassifizierung ist dies aber auf jeden Fall ausreichend.<br />
Ein weiterer Nachteil ist, dass aufgrund <strong>der</strong> spaltlosen Anordung Seeingeffekte 1 zum Tragen<br />
kommen.<br />
1 Als Seeing bezeichnet man die allgemeine Luftunruhe durch Strömungen warmer und kalter Luftschichten.