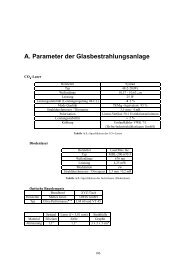Soziales Verhalten als Inszenierung unbewusster Strukturen
Soziales Verhalten als Inszenierung unbewusster Strukturen
Soziales Verhalten als Inszenierung unbewusster Strukturen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
In seiner hier angewandten Version bietet das Modell acht Cluster zur<br />
Beschreibung unterschiedlicher <strong>Verhalten</strong>squalitäten auf jeder der kreisförmigen<br />
<strong>Strukturen</strong>. Es ergeben sich insgesamt 24 Möglichkeiten der<br />
Kodierung für jede Äußerung. Die Kennzeichnung der Cluster erfolgt mit<br />
einem zweistelligen Code, wobei die Fokusebene mit einer ersten Ziffer<br />
gekennzeichnet wird (1 = transitiv, 2 = intransitiv, 3= introjektiv) und der<br />
Oktant mit der zweiten Ziffer, beginnend mit dem obersten Oktanten und<br />
dann im Uhrzeigersinn umlaufend.<br />
Das Beispiel „Ja, KM3 ... hatte ´ne ziemlich wichtige Funktion, den<br />
Gruppenprozess in Gang zu bringen“ wird entsprechend kodiert mit dem<br />
Cluster 1.4: Der Fokus ist transitiv, da KM3 versucht das Gegenüber, hier,<br />
die Gruppe, zu beeinflussen. Auf der Achse der Affiliation (liebevolle<br />
Verbundenheit versus Hass und Vernichtung) ist die Beeinflussung in einem<br />
unterstützenden, anleitenden und bestärkenden Sinne <strong>als</strong> durchaus<br />
freundlich, auf der Achse der Interdependenz <strong>als</strong> eher direktiv zu verstehen.<br />
Das SASB-Modell erlaubt es damit, eine gleichzeitig systematische und<br />
differenzierte Beziehungsschilderung vorzunehmen, die überprüfbar und<br />
nachvollziehbar ist.<br />
Im Verlauf des Kommunikationsprozesses gibt es typische Konfigurationen,<br />
die im Folgenden dargestellt sind (Tress und Junkert 1993a, S. 44f.):<br />
Komplementarität: Komplementäre Interaktionen unterscheiden sich lediglich<br />
auf der Fokus-Ebene (aktiv-transitiv versus reaktiv-intransitiv), sind aber in<br />
ihren Affiliations- und Interdependenzwerten identisch. Gemeint ist hier die<br />
Tendenz zur Reziprozität im sozialen Austausch, gemäß der Volksweisheit:<br />
Wie es in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder heraus.<br />
Untersuchungen haben ergeben, dass komplementäre Interaktionsfolgen in<br />
Beratungsgesprächen im Zweipersonensetting, aber auch in der Fallsupervision<br />
im Gruppensetting die überwiegende Mehrheit der Kodierungen bilden<br />
(Tress und Junkert 1993a, Hartkamp und Wöller 1997).<br />
Negative Komplementarität: Dieser Begriff meint den gerade unter dem<br />
Aspekt der Gegenübertragung triftigen Fall, dass eine Beraterin oder ein<br />
Berater negative Affiliationswerte der Ratsuchenden (1.6 bis 1.8: anklagen,<br />
vernichten, übergehen) mit gleicher Münze komplementär heimzahlt. Wenn<br />
derlei „negative“ Komplementarität sich in komplexe Interaktionen (s. u.) <strong>als</strong><br />
dessen Untertöne einschleicht, entfaltet sich in der Kommunikation eine<br />
384