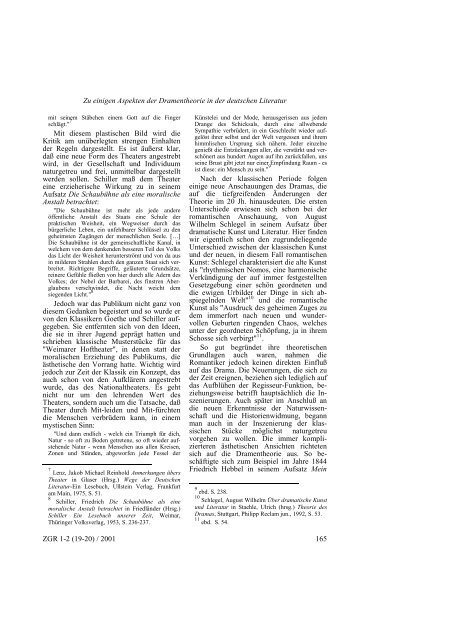ZGR Nr. 19-20/2001 - Partea II
ZGR Nr. 19-20/2001 - Partea II
ZGR Nr. 19-20/2001 - Partea II
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Zu einigen Aspekten der Dramentheorie in der deutschen Literatur<br />
mit seinem Stäbchen einem Gott auf die Finger<br />
schlägt." 7<br />
Mit diesem plastischen Bild wird die<br />
Kritik am unüberlegten strengen Einhalten<br />
der Regeln dargestellt. Es ist äußerst klar,<br />
daß eine neue Form des Theaters angestrebt<br />
wird, in der Gesellschaft und Individuum<br />
naturgetreu und frei, unmittelbar dargestellt<br />
werden sollen. Schiller maß dem Theater<br />
eine erzieherische Wirkung zu in seinem<br />
Aufsatz Die Schaubühne als eine moralische<br />
Anstalt betrachtet:<br />
"Die Schaubühne ist mehr als jede andere<br />
öffentliche Anstalt des Staats eine Schule der<br />
praktischen Weisheit, ein Wegweiser durch das<br />
bürgerliche Leben, ein unfehlbarer Schlüssel zu den<br />
geheimsten Zugängen der menschlichen Seele. […]<br />
Die Schaubühne ist der gemeinschaftliche Kanal, in<br />
welchem von dem denkenden besseren Teil des Volks<br />
das Licht der Weisheit herunterströmt und von da aus<br />
in milderen Strahlen durch den ganzen Staat sich verbreitet.<br />
Richtigere Begriffe, geläuterte Grundsätze,<br />
reinere Gefühle fließen von hier durch alle Adern des<br />
Volkes; der Nebel der Barbarei, des finstren Aberglaubens<br />
verschwindet, die Nacht weicht dem<br />
siegenden Licht." 8<br />
Jedoch war das Publikum nicht ganz von<br />
diesem Gedanken begeistert und so wurde er<br />
von den Klassikern Goethe und Schiller aufgegeben.<br />
Sie entfernten sich von den Ideen,<br />
die sie in ihrer Jugend geprägt hatten und<br />
schrieben klassische Musterstücke für das<br />
"Weimarer Hoftheater", in denen statt der<br />
moralischen Erziehung des Publikums, die<br />
ästhetische den Vorrang hatte. Wichtig wird<br />
jedoch zur Zeit der Klassik ein Konzept, das<br />
auch schon von den Aufklärern angestrebt<br />
wurde, das des Nationaltheaters. Es geht<br />
nicht nur um den lehrenden Wert des<br />
Theaters, sondern auch um die Tatsache, daß<br />
Theater durch Mit-leiden und Mit-fürchten<br />
die Menschen verbrüdern kann, in einem<br />
mystischen Sinn:<br />
"Und dann endlich - welch ein Triumph für dich,<br />
Natur - so oft zu Boden getretene, so oft wieder aufstehende<br />
Natur - wenn Menschen aus allen Kreisen,<br />
Zonen und Ständen, abgeworfen jede Fessel der<br />
7 Lenz, Jakob Michael Reinhold Anmerkungen übers<br />
Theater in Glaser (Hrsg.) Wege der Deutschen<br />
Literatur-Ein Lesebuch, Ullstein Verlag, Frankfurt<br />
am Main, <strong>19</strong>75, S. 51.<br />
8 Schiller, Friedrich Die Schaubühne als eine<br />
moralische Anstalt betrachtet in Friedländer (Hrsg.)<br />
Schiller Ein Lesebuch unserer Zeit, Weimar,<br />
Thüringer Volksverlag, <strong>19</strong>53, S. 236-237.<br />
Künstelei und der Mode, herausgerissen aus jedem<br />
Drange des Schicksals, durch eine allwebende<br />
Sympathie verbrüdert, in ein Geschlecht wieder aufgelöst<br />
ihrer selbst und der Welt vergessen und ihrem<br />
himmlischen Ursprung sich nähern. Jeder einzelne<br />
genießt die Entzückungen aller, die verstärkt und verschönert<br />
aus hundert Augen auf ihn zurückfallen, uns<br />
seine Brust gibt jetzt nur einer Empfindung Raum - es<br />
ist diese: ein Mensch zu sein." 9<br />
Nach der klassischen Periode folgen<br />
einige neue Anschauungen des Dramas, die<br />
auf die tiefgreifenden Änderungen der<br />
Theorie im <strong>20</strong> Jh. hinausdeuten. Die ersten<br />
Unterschiede erwiesen sich schon bei der<br />
romantischen Anschauung, von August<br />
Wilhelm Schlegel in seinem Aufsatz über<br />
dramatische Kunst und Literatur. Hier finden<br />
wir eigentlich schon den zugrundeliegende<br />
Unterschied zwischen der klassischen Kunst<br />
und der neuen, in diesem Fall romantischen<br />
Kunst: Schlegel charakterisiert die alte Kunst<br />
als "rhythmischen Nomos, eine harmonische<br />
Verkündigung der auf immer festgestellten<br />
Gesetzgebung einer schön geordneten und<br />
die ewigen Urbilder der Dinge in sich abspiegelnden<br />
Welt" 10 und die romantische<br />
Kunst als "Ausdruck des geheimen Zuges zu<br />
dem immerfort nach neuen und wundervollen<br />
Geburten ringenden Chaos, welches<br />
unter der geordneten Schöpfung, ja in ihrem<br />
Schosse sich verbirgt" 11 .<br />
So gut begründet ihre theoretischen<br />
Grundlagen auch waren, nahmen die<br />
Romantiker jedoch keinen direkten Einfluß<br />
auf das Drama. Die Neuerungen, die sich zu<br />
der Zeit ereignen, beziehen sich lediglich auf<br />
das Aufblühen der Regisseur-Funktion, beziehungsweise<br />
betrifft hauptsächlich die Inszenierungen.<br />
Auch später im Anschluß an<br />
die neuen Erkenntnisse der Naturwissenschaft<br />
und die Historienwidmung, begann<br />
man auch in der Inszenierung der klassischen<br />
Stücke möglichst naturgetreu<br />
vorgehen zu wollen. Die immer komplizierteren<br />
ästhetischen Ansichten richteten<br />
sich auf die Dramentheorie aus. So beschäftigte<br />
sich zum Beispiel im Jahre 1844<br />
Friedrich Hebbel in seinem Aufsatz Mein<br />
9 ebd. S. 238.<br />
10 Schlegel, August Wilhelm Über dramatische Kunst<br />
und Literatur in Staehle, Ulrich (hrsg.) Theorie des<br />
Dramas, Stuttgart, Philipp Reclam jun., <strong>19</strong>92, S. 53.<br />
11 ebd. S. 54.<br />
<strong>ZGR</strong> 1-2 (<strong>19</strong>-<strong>20</strong>) / <strong>20</strong>01 165