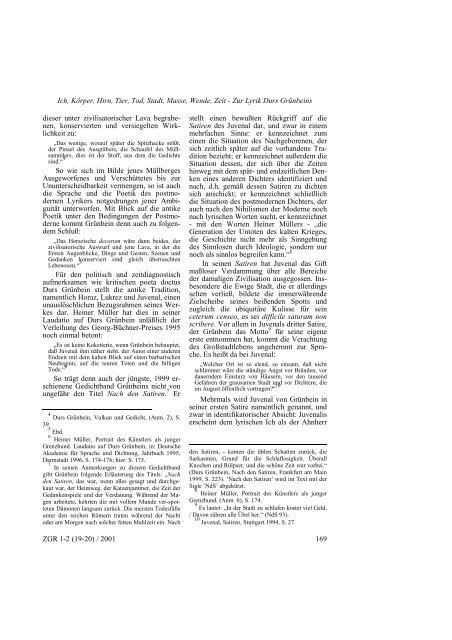ZGR Nr. 19-20/2001 - Partea II
ZGR Nr. 19-20/2001 - Partea II
ZGR Nr. 19-20/2001 - Partea II
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ich, Körper, Hirn, Tier, Tod, Stadt, Masse, Wende, Zeit - Zur Lyrik Durs Grünbeins<br />
dieser unter zivilisatorischer Lava begrabenen,<br />
konservierten und versiegelten Wirklichkeit<br />
zu:<br />
„Das wenige, worauf später die Spitzhacke stößt,<br />
der Pinsel des Ausgräbers, die Schaufel des Müllsammlers,<br />
dies ist der Stoff, aus dem die Gedichte<br />
sind.“ 4<br />
So wie sich im Bilde jenes Müllberges<br />
Ausgeworfenes und Verschüttetes bis zur<br />
Ununterscheidbarkeit vermengen, so ist auch<br />
die Sprache und die Poetik des postmodernen<br />
Lyrikers notgedrungen jener Ambiguität<br />
unterworfen. Mit Blick auf die antike<br />
Poetik unter den Bedingungen der Postmoderne<br />
kommt Grünbein denn auch zu folgendem<br />
Schluß:<br />
„Das Horazische decorum wäre dann beides, der<br />
zivilisatorische Auswurf und jene Lava, in der die<br />
Ersten Augenblicke, Dinge und Gesten, Szenen und<br />
Gedanken konserviert sind gleich überraschten<br />
Lebewesen.“ 5<br />
Für den politisch und zeitdiagnostisch<br />
aufmerksamen wie kritischen poeta doctus<br />
Durs Grünbein stellt die antike Tradition,<br />
namentlich Horaz, Lukrez und Juvenal, einen<br />
unauslöschlichen Bezugsrahmen seines Werkes<br />
dar. Heiner Müller hat dies in seiner<br />
Laudatio auf Durs Grünbein anläßlich der<br />
Verleihung des Georg-Büchner-Preises <strong>19</strong>95<br />
noch einmal betont:<br />
„Es ist keine Koketterie, wenn Grünbein behauptet,<br />
daß Juvenal ihm näher steht, der Autor einer anderen<br />
Endzeit mit dem kalten Blick auf einen barbarischen<br />
Neubeginn, auf die teuren Toten und die billigen<br />
Tode.“ 6<br />
So trägt denn auch der jüngste, <strong>19</strong>99 erschienene<br />
Gedichtband Grünbeins nicht von<br />
ungefähr den Titel Nach den Satiren. 7 Er<br />
4<br />
Durs Grünbein, Vulkan und Gedicht, (Anm. 2), S.<br />
39.<br />
5<br />
Ebd.<br />
6<br />
Heiner Müller, Portrait des Künstlers als junger<br />
Grenzhund. Laudatio auf Durs Grünbein, in: Deutsche<br />
Akademie für Sprache und Dichtung, Jahrbuch <strong>19</strong>95,<br />
Darmstadt <strong>19</strong>96, S. 174-176; hier: S. 175.<br />
7<br />
In seinen Anmerkungen zu diesem Gedichtband<br />
gibt Grünbein folgende Erläuterung des Titels: „Nach<br />
den Satiren, das war, wenn alles gesagt und durchgekaut<br />
war, der Heimweg, der Katzenjammer, die Zeit der<br />
Gedankenspiele und der Verdauung. Während der Magen<br />
arbeitete, kehrten die mit vollem Munde ver-spotteten<br />
Dämonen langsam zurück. Die meisten Todesfälle<br />
unter den reichen Römern traten während der Nacht<br />
oder am Morgen nach solcher fetten Mahlzeit ein. Nach<br />
stellt einen bewußten Rückgriff auf die<br />
Satiren des Juvenal dar, und zwar in einem<br />
mehrfachen Sinne: er kennzeichnet zum<br />
einen die Situation des Nachgeborenen, der<br />
sich zeitlich später auf die vorhandene Tradition<br />
bezieht; er kennzeichnet außerdem die<br />
Situation dessen, der sich über die Zeiten<br />
hinweg mit dem spät- und endzeitlichen Denken<br />
eines anderen Dichters identifiziert und<br />
nach, d.h. gemäß dessen Satiren zu dichten<br />
sich anschickt; er kennzeichnet schließlich<br />
die Situation des postmodernen Dichters, der<br />
auch nach den Nihilismen der Moderne noch<br />
nach lyrischen Worten sucht, er kennzeichnet<br />
- mit den Worten Heiner Müllers - „die<br />
Generation der Untoten des kalten Krieges,<br />
die Geschichte nicht mehr als Sinngebung<br />
des Sinnlosen durch Ideologie, sondern nur<br />
noch als sinnlos begreifen kann.“ 8<br />
In seinen Satiren hat Juvenal das Gift<br />
maßloser Verdammung über alle Bereiche<br />
der damaligen Zivilisation ausgegossen. Insbesondere<br />
die Ewige Stadt, die er allerdings<br />
selten verließ, bildete die immerwährende<br />
Zielscheibe seines beißenden Spotts und<br />
zugleich die ubiquitäre Kulisse für sein<br />
ceterum censeo, es sei difficile saturam non<br />
scribere. Vor allem in Juvenals dritter Satire,<br />
der Grünbein das Motto 9 für seine eigene<br />
erste entnommen hat, kommt die Verachtung<br />
des Großstadtlebens ungehemmt zur Sprache.<br />
Es heißt da bei Juvenal:<br />
„Welcher Ort ist so elend, so einsam, daß nicht<br />
schlimmer wäre die ständige Angst vor Bränden, vor<br />
dauerndem Einsturz von Häusern, vor den tausend<br />
Gefahren der grausamen Stadt und vor Dichtern, die<br />
im August öffentlich vortragen?“ 10<br />
Mehrmals wird Juvenal von Grünbein in<br />
seiner ersten Satire namentlich genannt, und<br />
zwar in identifikatorischer Absicht: Juvenalis<br />
erscheint dem lyrischen Ich als der Ahnherr<br />
den Satiren, - kamen die üblen Schatten zurück, die<br />
Sarkasmen, Grund für die Schlaflosigkeit. Überall<br />
Knochen und Rülpser, und die schöne Zeit war vorbei.“<br />
(Durs Grünbein, Nach den Satiren, Frankfurt am Main<br />
<strong>19</strong>99, S. 223). ‘Nach den Satiren’ wird im Text mit der<br />
Sigle ‘NdS’ abgekürzt.<br />
8 Heiner Müller, Portrait des Künstlers als junger<br />
Grenzhund, (Anm. 6), S. 174.<br />
9 Es lautet: „In der Stadt zu schlafen kostet viel Geld,<br />
/ Davon rühren alle Übel her.“ (NdS 93).<br />
10 Juvenal, Satiren, Stuttgart <strong>19</strong>94, S. 27.<br />
<strong>ZGR</strong> 1-2 (<strong>19</strong>-<strong>20</strong>) / <strong>20</strong>01 169