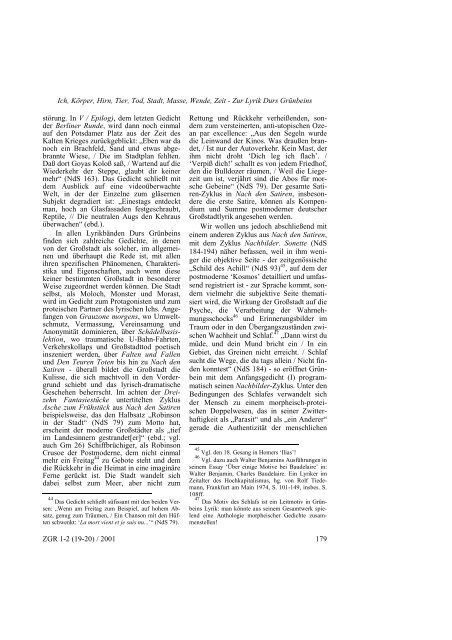ZGR Nr. 19-20/2001 - Partea II
ZGR Nr. 19-20/2001 - Partea II
ZGR Nr. 19-20/2001 - Partea II
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ich, Körper, Hirn, Tier, Tod, Stadt, Masse, Wende, Zeit - Zur Lyrik Durs Grünbeins<br />
störung. In V / Epilog), dem letzten Gedicht<br />
der Berliner Runde, wird dann noch einmal<br />
auf den Potsdamer Platz aus der Zeit des<br />
Kalten Krieges zurückgeblickt: „Eben war da<br />
noch ein Brachfeld, Sand und etwas abgebrannte<br />
Wiese, / Die im Stadtplan fehlten.<br />
Daß dort Goyas Koloß saß, / Wartend auf die<br />
Wiederkehr der Steppe, glaubt dir keiner<br />
mehr“ (NdS 163). Das Gedicht schließt mit<br />
dem Ausblick auf eine videoüberwachte<br />
Welt, in der der Einzelne zum gläsernen<br />
Subjekt degradiert ist: „Einestags entdeckt<br />
man, hoch an Glasfassaden festgeschraubt,<br />
Reptile, // Die neutralen Augs den Kehraus<br />
überwachen“ (ebd.).<br />
In allen Lyrikbänden Durs Grünbeins<br />
finden sich zahlreiche Gedichte, in denen<br />
von der Großstadt als solcher, im allgemeinen<br />
und überhaupt die Rede ist, mit allen<br />
ihren spezifischen Phänomenen, Charakteristika<br />
und Eigenschaften, auch wenn diese<br />
keiner bestimmten Großstadt in besonderer<br />
Weise zugeordnet werden können. Die Stadt<br />
selbst, als Moloch, Monster und Morast,<br />
wird im Gedicht zum Protagonisten und zum<br />
proteischen Partner des lyrischen Ichs. Angefangen<br />
von Grauzone morgens, wo Umweltschmutz,<br />
Vermassung, Vereinsamung und<br />
Anonymität dominieren, über Schädelbasislektion,<br />
wo traumatische U-Bahn-Fahrten,<br />
Verkehrskollaps und Großstadttod poetisch<br />
inszeniert werden, über Falten und Fallen<br />
und Den Teuren Toten bis hin zu Nach den<br />
Satiren - überall bildet die Großstadt die<br />
Kulisse, die sich machtvoll in den Vordergrund<br />
schiebt und das lyrisch-dramatische<br />
Geschehen beherrscht. Im achten der Dreizehn<br />
Fantasiestücke untertitelten Zyklus<br />
Asche zum Frühstück aus Nach den Satiren<br />
beispielsweise, das den Halbsatz „Robinson<br />
in der Stadt“ (NdS 79) zum Motto hat,<br />
erscheint der moderne Großstädter als „tief<br />
im Landesinnern gestrandet[er]“ (ebd.; vgl.<br />
auch Gm 26) Schiffbrüchiger, als Robinson<br />
Crusoe der Postmoderne, dem nicht einmal<br />
mehr ein Freitag 44 zu Gebote steht und dem<br />
die Rückkehr in die Heimat in eine imaginäre<br />
Ferne gerückt ist. Die Stadt wandelt sich<br />
dabei selbst zum Meer, aber nicht zum<br />
44 Das Gedicht schließt süfissant mit den beiden Versen:<br />
„Wenn am Freitag zum Beispiel, auf hohem Absatz,<br />
genug zum Träumen, / Ein Chanson mit den Hüften<br />
schwenkt: ‘La mort vient et je suis nu...’“ (NdS 79).<br />
Rettung und Rückkehr verheißenden, sondern<br />
zum versteinerten, anti-utopischen Ozean<br />
par excellence: „Aus den Segeln wurde<br />
die Leinwand der Kinos. Was draußen brandet,<br />
/ Ist nur der Autoverkehr. Kein Mast, der<br />
ihm nicht droht ‘Dich leg ich flach’. /<br />
‘Verpiß dich!’ schallt es von jedem Friedhof,<br />
den die Bulldozer räumen, / Weil die Liegezeit<br />
um ist, verjährt sind die Abos für morsche<br />
Gebeine“ (NdS 79). Der gesamte Satiren-Zyklus<br />
in Nach den Satiren, insbesondere<br />
die erste Satire, können als Kompendium<br />
und Summe postmoderner deutscher<br />
Großstadtlyrik angesehen werden.<br />
Wir wollen uns jedoch abschließend mit<br />
einem anderen Zyklus aus Nach den Satiren,<br />
mit dem Zyklus Nachbilder. Sonette (NdS<br />
184-<strong>19</strong>4) näher befassen, weil in ihm weniger<br />
die objektive Seite - der zeitgenössische<br />
„Schild des Achill“ (NdS 93) 45 , auf dem der<br />
postmoderne ‘Kosmos’ detailliert und umfassend<br />
registriert ist - zur Sprache kommt, sondern<br />
vielmehr die subjektive Seite thematisiert<br />
wird, die Wirkung der Großstadt auf die<br />
Psyche, die Verarbeitung der Wahrnehmungsschocks<br />
46 und Erinnerungsbilder im<br />
Traum oder in den Übergangszuständen zwischen<br />
Wachheit und Schlaf. 47 „Dann wirst du<br />
müde, und dein Mund bricht ein / In ein<br />
Gebiet, das Greinen nicht erreicht. / Schlaf<br />
sucht die Wege, die du tags allein / Nicht finden<br />
konntest“ (NdS 184) - so eröffnet Grünbein<br />
mit dem Anfangsgedicht (I) programmatisch<br />
seinen Nachbilder-Zyklus. Unter den<br />
Bedingungen des Schlafes verwandelt sich<br />
der Mensch zu einem morpheisch-proteischen<br />
Doppelwesen, das in seiner Zwitterhaftigkeit<br />
als „Parasit“ und als „ein Anderer“<br />
gerade die Authentizität der menschlichen<br />
45 Vgl. den 18. Gesang in Homers ‘Ilias’!<br />
46 Vgl. dazu auch Walter Benjamins Ausführungen in<br />
seinem Essay ‘Über einige Motive bei Baudelaire’ in:<br />
Walter Benjamin, Charles Baudelaire. Ein Lyriker im<br />
Zeitalter des Hochkapitalismus, hg. von Rolf Tiedemann,<br />
Frankfurt am Main <strong>19</strong>74, S. 101-149, insbes. S.<br />
108ff.<br />
47 Das Motiv des Schlafs ist ein Leitmotiv in Grünbeins<br />
Lyrik: man könnte aus seinem Gesamtwerk spielend<br />
eine Anthologie morpheischer Gedichte zusammenstellen!<br />
<strong>ZGR</strong> 1-2 (<strong>19</strong>-<strong>20</strong>) / <strong>20</strong>01 179