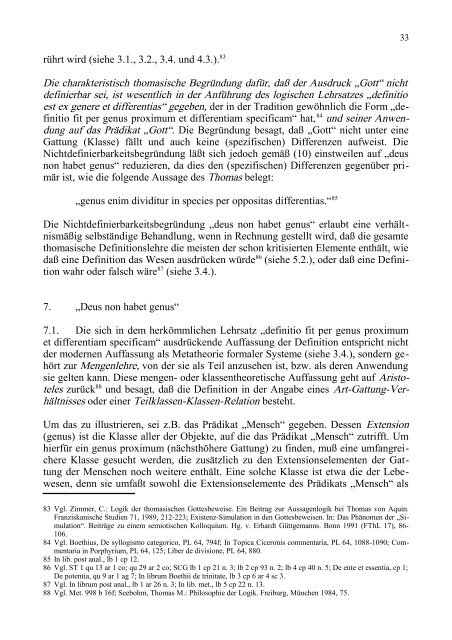Definierbarkeit und Definition des Ausdrucks „Gott“ - Christoph Zimmer
Definierbarkeit und Definition des Ausdrucks „Gott“ - Christoph Zimmer
Definierbarkeit und Definition des Ausdrucks „Gott“ - Christoph Zimmer
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
33<br />
rührt wird (siehe 3.1., 3.2., 3.4. <strong>und</strong> 4.3.). 83<br />
Die charakteristisch thomasische Begründung dafür, daß der Ausdruck <strong>„Gott“</strong> nicht<br />
definierbar sei, ist wesentlich in der Anführung <strong>des</strong> logischen Lehrsatzes „definitio<br />
est ex genere et differentias“ gegeben, der in der Tradition gewöhnlich die Form „definitio<br />
fit per genus proximum et differentiam specificam“ hat, 84 <strong>und</strong> seiner Anwendung<br />
auf das Prädikat <strong>„Gott“</strong>. Die Begründung besagt, daß <strong>„Gott“</strong> nicht unter eine<br />
Gattung (Klasse) fällt <strong>und</strong> auch keine (spezifischen) Differenzen aufweist. Die<br />
Nichtdefinierbarkeitsbegründung läßt sich jedoch gemäß (10) einstweilen auf „deus<br />
non habet genus“ reduzieren, da dies den (spezifischen) Differenzen gegenüber primär<br />
ist, wie die folgende Aussage <strong>des</strong> Thomas belegt:<br />
„genus enim dividitur in species per oppositas differentias.“ 85<br />
Die Nichtdefinierbarkeitsbegründung „deus non habet genus“ erlaubt eine verhältnismäßig<br />
selbständige Behandlung, wenn in Rechnung gestellt wird, daß die gesamte<br />
thomasische <strong>Definition</strong>slehre die meisten der schon kritisierten Elemente enthält, wie<br />
daß eine <strong>Definition</strong> das Wesen ausdrücken würde 86 (siehe 5.2.), oder daß eine <strong>Definition</strong><br />
wahr oder falsch wäre 87 (siehe 3.4.).<br />
7. „Deus non habet genus“<br />
7.1. Die sich in dem herkömmlichen Lehrsatz „definitio fit per genus proximum<br />
et differentiam specificam“ ausdrückende Auffassung der <strong>Definition</strong> entspricht nicht<br />
der modernen Auffassung als Metatheorie formaler Systeme (siehe 3.4.), sondern gehört<br />
zur Mengenlehre, von der sie als Teil anzusehen ist, bzw. als deren Anwendung<br />
sie gelten kann. Diese mengen- oder klassentheoretische Auffassung geht auf Aristoteles<br />
zurück 88 <strong>und</strong> besagt, daß die <strong>Definition</strong> in der Angabe eines Art-Gattung-Verhältnisses<br />
oder einer Teilklassen-Klassen-Relation besteht.<br />
Um das zu illustrieren, sei z.B. das Prädikat „Mensch“ gegeben. Dessen Extension<br />
(genus) ist die Klasse aller der Objekte, auf die das Prädikat „Mensch“ zutrifft. Um<br />
hierfür ein genus proximum (nächsthöhere Gattung) zu finden, muß eine umfangreichere<br />
Klasse gesucht werden, die zusätzlich zu den Extensionselementen der Gattung<br />
der Menschen noch weitere enthält. Eine solche Klasse ist etwa die der Lebewesen,<br />
denn sie umfaßt sowohl die Extensionselemente <strong>des</strong> Prädikats „Mensch“ als<br />
83 Vgl. <strong>Zimmer</strong>, C.: Logik der thomasischen Gottesbeweise. Ein Beitrag zur Aussagenlogik bei Thomas von Aquin.<br />
Franziskanische Studien 71, 1989, 212-223; Existenz-Simulation in den Gottesbeweisen. In: Das Phänomen der „Simulation“.<br />
Beiträge zu einem semiotischen Kolloquium. Hg. v. Erhardt Güttgemanns. Bonn 1991 (FThL 17), 86-<br />
106.<br />
84 Vgl. Boethius, De syllogismo categorico, PL 64, 794f; In Topica Ciceronis commentaria, PL 64, 1088-1090; Commentaria<br />
in Porphyrium, PL 64, 125; Liber de divisione, PL 64, 880.<br />
85 In lib. post anal., lb 1 cp 12.<br />
86 Vgl. ST 1 qu 13 ar 1 co; qu 29 ar 2 co; SCG lb 1 cp 21 n. 3; lb 2 cp 93 n. 2; lb 4 cp 40 n. 5; De ente et essentia, cp 1;<br />
De potentia, qu 9 ar 1 ag 7; In librum Boethii de trinitate, lb 3 cp 6 ar 4 sc 3.<br />
87 Vgl. In librum post anal., lb 1 ar 26 n. 3; In lib. met., lb 5 cp 22 n. 13.<br />
88 Vgl. Met. 998 b 16f; Seebohm, Thomas M.: Philosophie der Logik. Freiburg, München 1984, 75.