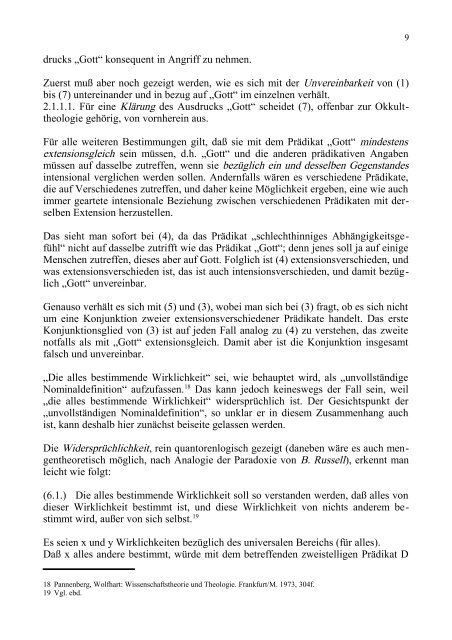Definierbarkeit und Definition des Ausdrucks „Gott“ - Christoph Zimmer
Definierbarkeit und Definition des Ausdrucks „Gott“ - Christoph Zimmer
Definierbarkeit und Definition des Ausdrucks „Gott“ - Christoph Zimmer
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
9<br />
drucks <strong>„Gott“</strong> konsequent in Angriff zu nehmen.<br />
Zuerst muß aber noch gezeigt werden, wie es sich mit der Unvereinbarkeit von (1)<br />
bis (7) untereinander <strong>und</strong> in bezug auf <strong>„Gott“</strong> im einzelnen verhält.<br />
2.1.1.1. Für eine Klärung <strong>des</strong> <strong>Ausdrucks</strong> <strong>„Gott“</strong> scheidet (7), offenbar zur Okkulttheologie<br />
gehörig, von vornherein aus.<br />
Für alle weiteren Bestimmungen gilt, daß sie mit dem Prädikat <strong>„Gott“</strong> min<strong>des</strong>tens<br />
extensionsgleich sein müssen, d.h. <strong>„Gott“</strong> <strong>und</strong> die anderen prädikativen Angaben<br />
müssen auf dasselbe zutreffen, wenn sie bezüglich ein <strong>und</strong> <strong>des</strong>selben Gegenstan<strong>des</strong><br />
intensional verglichen werden sollen. Andernfalls wären es verschiedene Prädikate,<br />
die auf Verschiedenes zutreffen, <strong>und</strong> daher keine Möglichkeit ergeben, eine wie auch<br />
immer geartete intensionale Beziehung zwischen verschiedenen Prädikaten mit derselben<br />
Extension herzustellen.<br />
Das sieht man sofort bei (4), da das Prädikat „schlechthinniges Abhängigkeitsgefühl“<br />
nicht auf dasselbe zutrifft wie das Prädikat <strong>„Gott“</strong>; denn jenes soll ja auf einige<br />
Menschen zutreffen, dieses aber auf Gott. Folglich ist (4) extensionsverschieden, <strong>und</strong><br />
was extensionsverschieden ist, das ist auch intensionsverschieden, <strong>und</strong> damit bezüglich<br />
<strong>„Gott“</strong> unvereinbar.<br />
Genauso verhält es sich mit (5) <strong>und</strong> (3), wobei man sich bei (3) fragt, ob es sich nicht<br />
um eine Konjunktion zweier extensionsverschiedener Prädikate handelt. Das erste<br />
Konjunktionsglied von (3) ist auf jeden Fall analog zu (4) zu verstehen, das zweite<br />
notfalls als mit <strong>„Gott“</strong> extensionsgleich. Damit aber ist die Konjunktion insgesamt<br />
falsch <strong>und</strong> unvereinbar.<br />
„Die alles bestimmende Wirklichkeit“ sei, wie behauptet wird, als „unvollständige<br />
Nominaldefinition“ aufzufassen. 18 Das kann jedoch keineswegs der Fall sein, weil<br />
„die alles bestimmende Wirklichkeit“ widersprüchlich ist. Der Gesichtspunkt der<br />
„unvollständigen Nominaldefinition“, so unklar er in diesem Zusammenhang auch<br />
ist, kann <strong>des</strong>halb hier zunächst beiseite gelassen werden.<br />
Die Widersprüchlichkeit, rein quantorenlogisch gezeigt (daneben wäre es auch mengentheoretisch<br />
möglich, nach Analogie der Paradoxie von B. Russell), erkennt man<br />
leicht wie folgt:<br />
(6.1.) Die alles bestimmende Wirklichkeit soll so verstanden werden, daß alles von<br />
dieser Wirklichkeit bestimmt ist, <strong>und</strong> diese Wirklichkeit von nichts anderem bestimmt<br />
wird, außer von sich selbst. 19<br />
Es seien x <strong>und</strong> y Wirklichkeiten bezüglich <strong>des</strong> universalen Bereichs (für alles).<br />
Daß x alles andere bestimmt, würde mit dem betreffenden zweistelligen Prädikat D<br />
18 Pannenberg, Wolfhart: Wissenschaftstheorie <strong>und</strong> Theologie. Frankfurt/M. 1973, 304f.<br />
19 Vgl. ebd.