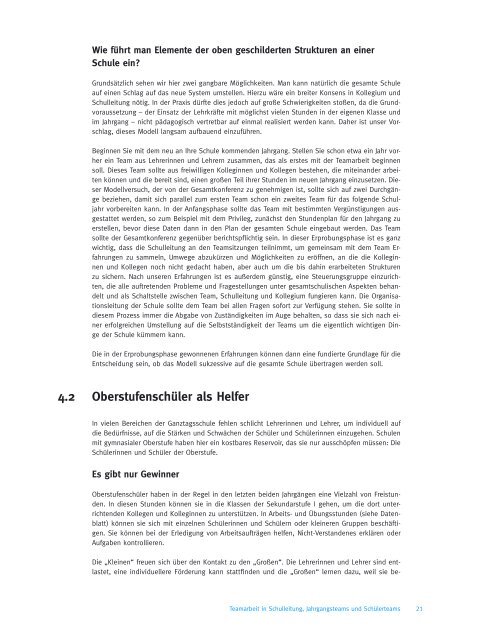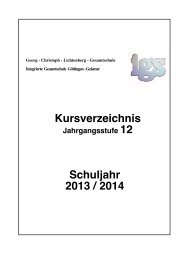GRUNDLAGEN GUTER SCHULE EIN PRAXISBUCH - IGS Göttingen
GRUNDLAGEN GUTER SCHULE EIN PRAXISBUCH - IGS Göttingen
GRUNDLAGEN GUTER SCHULE EIN PRAXISBUCH - IGS Göttingen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wie führt man Elemente der oben geschilderten Strukturen an einer<br />
Schule ein?<br />
Grundsätzlich sehen wir hier zwei gangbare Möglichkeiten. Man kann natürlich die gesamte Schule<br />
auf einen Schlag auf das neue System umstellen. Hierzu wäre ein breiter Konsens in Kollegium und<br />
Schulleitung nötig. In der Praxis dürfte dies jedoch auf große Schwierigkeiten stoßen, da die Grundvoraussetzung<br />
– der Einsatz der Lehrkräfte mit möglichst vielen Stunden in der eigenen Klasse und<br />
im Jahrgang – nicht pädagogisch vertretbar auf einmal realisiert werden kann. Daher ist unser Vorschlag,<br />
dieses Modell langsam aufbauend einzuführen.<br />
Beginnen Sie mit dem neu an Ihre Schule kommenden Jahrgang. Stellen Sie schon etwa ein Jahr vorher<br />
ein Team aus Lehrerinnen und Lehrern zusammen, das als erstes mit der Teamarbeit beginnen<br />
soll. Dieses Team sollte aus freiwilligen Kolleginnen und Kollegen bestehen, die miteinander arbeiten<br />
können und die bereit sind, einen großen Teil ihrer Stunden im neuen Jahrgang einzusetzen. Dieser<br />
Modellversuch, der von der Gesamtkonferenz zu genehmigen ist, sollte sich auf zwei Durchgänge<br />
beziehen, damit sich parallel zum ersten Team schon ein zweites Team für das folgende Schuljahr<br />
vorbereiten kann. In der Anfangsphase sollte das Team mit bestimmten Vergünstigungen ausgestattet<br />
werden, so zum Beispiel mit dem Privileg, zunächst den Stundenplan für den Jahrgang zu<br />
erstellen, bevor diese Daten dann in den Plan der gesamten Schule eingebaut werden. Das Team<br />
sollte der Gesamtkonferenz gegenüber berichtspflichtig sein. In dieser Erprobungsphase ist es ganz<br />
wichtig, dass die Schulleitung an den Teamsitzungen teilnimmt, um gemeinsam mit dem Team Erfahrungen<br />
zu sammeln, Umwege abzukürzen und Möglichkeiten zu eröffnen, an die die Kolleginnen<br />
und Kollegen noch nicht gedacht haben, aber auch um die bis dahin erarbeiteten Strukturen<br />
zu sichern. Nach unseren Erfahrungen ist es außerdem günstig, eine Steuerungsgruppe einzurichten,<br />
die alle auftretenden Probleme und Fragestellungen unter gesamtschulischen Aspekten behandelt<br />
und als Schaltstelle zwischen Team, Schulleitung und Kollegium fungieren kann. Die Organisationsleitung<br />
der Schule sollte dem Team bei allen Fragen sofort zur Verfügung stehen. Sie sollte in<br />
diesem Prozess immer die Abgabe von Zuständigkeiten im Auge behalten, so dass sie sich nach einer<br />
erfolgreichen Umstellung auf die Selbstständigkeit der Teams um die eigentlich wichtigen Dinge<br />
der Schule kümmern kann.<br />
Die in der Erprobungsphase gewonnenen Erfahrungen können dann eine fundierte Grundlage für die<br />
Entscheidung sein, ob das Modell sukzessive auf die gesamte Schule übertragen werden soll.<br />
4.2 Oberstufenschüler als Helfer<br />
In vielen Bereichen der Ganztagsschule fehlen schlicht Lehrerinnen und Lehrer, um individuell auf<br />
die Bedürfnisse, auf die Stärken und Schwächen der Schüler und Schülerinnen einzugehen. Schulen<br />
mit gymnasialer Oberstufe haben hier ein kostbares Reservoir, das sie nur ausschöpfen müssen: Die<br />
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe.<br />
Es gibt nur Gewinner<br />
Oberstufenschüler haben in der Regel in den letzten beiden Jahrgängen eine Vielzahl von Freistunden.<br />
In diesen Stunden können sie in die Klassen der Sekundarstufe I gehen, um die dort unterrichtenden<br />
Kollegen und Kolleginnen zu unterstützen. In Arbeits- und Übungsstunden (siehe Datenblatt)<br />
können sie sich mit einzelnen Schülerinnen und Schülern oder kleineren Gruppen beschäftigen.<br />
Sie können bei der Erledigung von Arbeitsaufträgen helfen, Nicht-Verstandenes erklären oder<br />
Aufgaben kontrollieren.<br />
Die „Kleinen“ freuen sich über den Kontakt zu den „Großen“. Die Lehrerinnen und Lehrer sind entlastet,<br />
eine individuellere Förderung kann stattfinden und die „Großen“ lernen dazu, weil sie be-<br />
Teamarbeit in Schulleitung, Jahrgangsteams und Schülerteams<br />
21