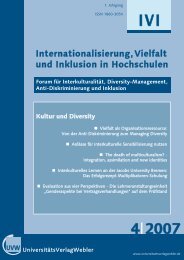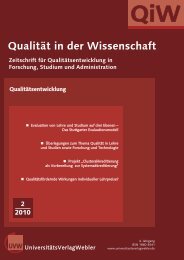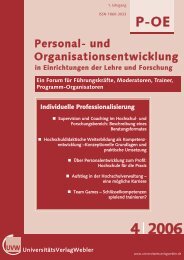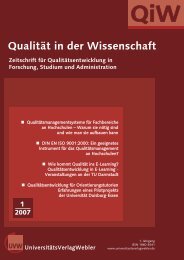QiW - UniversitätsVerlagWebler
QiW - UniversitätsVerlagWebler
QiW - UniversitätsVerlagWebler
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>QiW</strong><br />
U. Schmidt • Anmerkungen zum Stand der Qualitätssicherung im deutschen Hochschulsystem<br />
auf die Messung von Lehrkompetenz unter spezifischen<br />
Rahmenbedingungen in einem sehr allgemeinen Sinne. Die<br />
so gemessene Qualität legt in der Regel in Ermangelung<br />
von Daten auf der Ergebnisebene die Zufriedenheit der Studierenden<br />
als abhängige Variable zugrunde. In diesem Zusammenhang<br />
stellen die aktuellen Versuche Befragungsinstrumente<br />
stärker am Kompetenzerwerb der Studierenden<br />
zu orientieren einen gewissen Fortschritt dar (vgl. u.a.<br />
Braun et al. 2008), ohne das grundlegende Problem unklarer<br />
Zielbeschreibung und Operationalisierung sowie das<br />
Fehlen eines expliziten Qualitätsverständnisses lösen zu<br />
können.<br />
Die sich hieraus ergebende Schwierigkeit sei anhand eines<br />
Verfahrens erläutert, das im Rahmen der Lehrpreisvergabe<br />
in Rheinland-Pfalz Anwendung findet. In dem Bemühen für<br />
die Vergabe von Lehrpreisen die reine Lehrleistung, nicht<br />
aber beeinflussende Rahmenbedingungen zugrunde zu<br />
legen, wurden mit Blick auf das Gesamturteil der Studierenden<br />
aus der Forschung bekannte intervenierende Variablen<br />
in der Weise neutralisiert, als nicht Mittelwerte, sondern<br />
Residualwerte zugrunde gelegt wurden. Dies eröffnet auch<br />
Lehrenden, die unter schlechten Raumbedingungen lehren<br />
oder die Inhalte zu vermitteln haben, die keine große Resonanz<br />
bei Studierenden finden (z.B. Mathematik oder Chemie<br />
für Fachexterne oder Methoden der empirischen Sozialforschung)<br />
die Möglichkeit erhalten einen Lehrpreis zu<br />
gewinnen. Dieses Verfahren hat sich insgesamt bewährt,<br />
wirft aber dennoch die Frage auf, ob bspw. das frühzeitige<br />
Bemühen um angemessene Lehrräume oder die Wahl interessanter<br />
Themen durch Dozierende nicht selbst Qualitätskriterien<br />
sind, denen in dieser Weise nicht mehr hinreichend<br />
Rechnung getragen wird.<br />
Fasst man diese Überlegungen zur Bewertung von Handlungen<br />
zusammen, so lässt sich festhalten, dass es sich hierbei<br />
auch um Fragen der angemessenen Methoden, in erster<br />
Abbildung 3: Qualitätszirkel im Kontext von Lehrveranstaltungsbewertungen<br />
Linie aber um – und dies ist nicht ungewöhnlich für den Bereich<br />
der Evaluation – ein Problem ungenauer Zielexplikation<br />
und Operationalisierung in konkrete Handlungsweisen<br />
handelt.<br />
Dem entsprechend gestaltet sich auch die Umsetzung in<br />
konkrete Maßnahmen als voraussetzungsreich. Erschwerend<br />
hinzu kommt, dass Ergebnisse bspw. aus der Lehrund<br />
Lernforschung wie auch der Evaluation im Kontext von<br />
Qualitätssicherungsmaßnahmen selten systematisch aufgegriffen<br />
werden. Die Koppelung der Ergebnisse aus Lehrveranstaltungsbefragungen<br />
an konkrete hochschuldidaktische<br />
Angebote ist eher die Ausnahme als die Regel, obgleich<br />
bspw. zur Wirksamkeit von Beratungsangeboten zur Verbesserung<br />
der individuellen Lehrqualität im Anschluss an<br />
Evaluationen interessante und zielführende Ergebnisse vorliegen<br />
(vgl. hierzu u.a. Dresel et al. 2007).<br />
5. 10 Thesen zum Stand der<br />
Qualitätssicherung an Hochschulen<br />
An dieser Stelle sollen zusammenfassend sowie die vorherigen<br />
Einlassungen ergänzend einige kritische und charakteristische<br />
Aspekte zur Ausformung von Qualitätssicherungsverfahren<br />
an deutschen Hochschulen stichpunktartig<br />
genannt werden, welche die zu Beginn beschriebenen positiven<br />
Einschätzungen zur Entwicklung in den vergangenen<br />
Jahren nicht schmälern, gleichzeitig aber auf den nach wie<br />
vor enormen Entwicklungsbedarf hinweisen sollen.<br />
1. Betrachtet man das System der Qualitätssicherung in seinen<br />
unterschiedlichen Facetten, so fällt zunächst auf,<br />
dass neben den lange Zeit prägenden Begriff der Evaluation<br />
weitere Termini – wie Programmakkreditierung, Systemakkreditierung,<br />
Qualitätsmanagement, Institutionelle<br />
Evaluation, Quality Audit, Qualitätsmanagement usw.<br />
– getreten sind, die nicht nur in den Hochschulen selbst,<br />
sondern inzwischen auch bei den Protagnisten der entsprechenden<br />
Verfahren eine zunehmende<br />
Begriffsverwirrung hinterlassen, die insofern<br />
als problematisch einzustufen ist, als<br />
auf Seiten der Betroffenen die Verfahrenstransparenz<br />
gering ist und damit die<br />
Erwartungen diffus sind, was der nach wie<br />
vorhandenen Verfahrensskepsis nicht entgegen<br />
wirkt, sondern diese weiter verstärkt.<br />
Eine präzisere Verwendung dieser<br />
Begriffe und vor allem die funktionale Differenzierung<br />
entsprechender Verfahren<br />
wäre hilfreich und würde dazu beitragen<br />
auf Seiten aller Akteursgruppen Vertrauen<br />
in unterschiedliche Zugänge der Qualitätssicherung<br />
zu generieren.<br />
2. Obgleich mit der Zunahme integrierter<br />
Qualitätssicherungssysteme erste<br />
Schritte umgesetzt wurden einzelne<br />
Verfahren besser aufeinander abzustimmen<br />
– wie im Fall der Bezugnahme interner<br />
und externer Evaluationen und<br />
Akkreditierungen – fällt die nach wie<br />
vor bestehende Differenzierung zwischen<br />
Forschungs- und Lehrevaluation<br />
ins Auge, die auch immer noch eine<br />
<strong>QiW</strong> 1+2/2009<br />
7