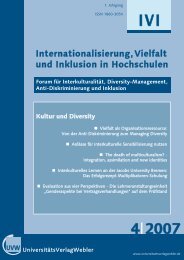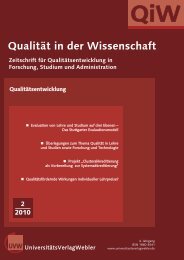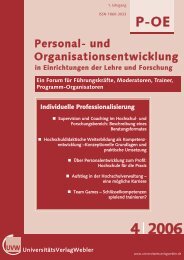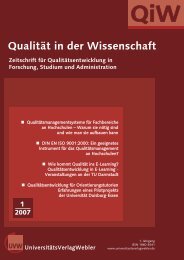QiW - UniversitätsVerlagWebler
QiW - UniversitätsVerlagWebler
QiW - UniversitätsVerlagWebler
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>QiW</strong><br />
U. Schmidt • Anmerkungen zum Stand der Qualitätssicherung im deutschen Hochschulsystem<br />
gleichs von Zielen oder Erwartungen mit deren Erfüllung.<br />
Die Entwicklungsfunktion zielt in erster Linie auf den prospektiven<br />
Charakter von Qualitätssicherung und Entwicklungspotenziale<br />
ab. Die Legitimitätsfunktion umschreibt<br />
Evaluation bzw. Qualitätssicherung als Instrument der Generierung<br />
von Daten und Ergebnissen, die vor allem in der<br />
organisationalen Außenperspektive die Zielerfüllung kontrolliert<br />
und dokumentiert. Schließlich ist die Forschungsfunktion<br />
zu nennen, die Evaluation als Instrument zur Generierung<br />
neuen Wissens in den Vordergrund rückt (vgl.<br />
Stockmann 2000, Kromrey 2000, Schmidt 2008). Diese<br />
Funktionen treten in der Praxis zwar in unterschiedlichen<br />
Gewichtungen, jedoch in der Regel stets gleichzeitig auf.<br />
Dennoch lassen sich entlang einzelner Evaluationsinstrumente<br />
und -verfahren Gewichtungen beobachten, die in typisierender<br />
Weise für den Bereich der Qualitätssicherung<br />
an Hochschulen folgend dargestellt sind.<br />
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass für den Bereich der<br />
Qualitätssicherung an Hochschulen vor allem mit Blick auf<br />
Peer Reviews, Akkreditierungsverfahren und Rankings<br />
sowie Ratings – sowohl für Forschungs- als auch Lehrleistungen<br />
– ein vergleichsweise geringer Forschungsbezug zu<br />
konstatieren ist. Instrumente wie auch die mit einzelnen<br />
Fragestellungen und Indikatoren unterstellten Wirkungen<br />
von Handlungen basieren im Wesentlichen auf Plausibilitätsunterstellungen,<br />
dem Konsens hochschulpolitisch relevanter<br />
Akteure und persönlichen Erfahrungen. Im Hinblick<br />
auf die Erhebungsinstrumente, wie bspw. Leitfäden im Rahmen<br />
von internen und externen Evaluationen oder im Kontext<br />
von Akkreditierungsverfahren, spielen methodische<br />
Fragen mit Blick auf die Gütekriterien empirischer Sozialforschung<br />
häufig eine nachgeordnete Rolle. Somit werden<br />
nicht nur die grundlegenden Fragestellungen in den einzelnen<br />
Verfahren, sondern auch ihre<br />
methodische Umsetzung auf Aushandlungsprozesse<br />
reduziert, die<br />
Analysen und insbesondere die Messung<br />
von Wirkungen im Sinne intendierter<br />
und nicht intendierter Handlungsfolgen<br />
von eingeleiteten Maßnahmen<br />
zumindest fragil erscheinen<br />
lassen. An die Stelle hinreichend validierter<br />
Methoden treten die Legitimation<br />
durch Verfahren und die Delegation<br />
an externe Gutachter. Dies<br />
mag in vielen Fällen ein probates<br />
Mittel zur Initiierung von Qualitätsentwicklung<br />
sein, wenngleich die<br />
Rolle der Peers in der Evaluation<br />
nicht unumstritten ist (vgl. u.a. Reinhart<br />
2006). Zu einer durch Forschungsergebnisse<br />
geleiteten Evaluation<br />
führt dies allerdings nicht,<br />
was sich tendenziell auch an der nur<br />
mittelmäßigen Akzeptanz und Wirkung<br />
externer Begutachtungen im<br />
Bereich von Studium und Lehre ablesen<br />
lässt (vgl. Mittag 2006).<br />
Im Vergleich hierzu ist der Forschungsbezug<br />
bei Lehrveranstaltungs-,<br />
Absolventenbefragungen<br />
und Studienverlaufsanalysen als etwas höher einzustufen.<br />
So lässt sich mittlerweile eine Vielzahl von Projekten beobachten,<br />
die sowohl auf die Optimierung von Erhebungsinstrumenten<br />
als auch auf die systematische Ergebnisanalyse<br />
abstellen (vgl. u.a. Mutz, Daniel 2008).<br />
Sieht man von Studienverlaufsanalysen ab, so ist allen Verfahren<br />
eine mehr oder weniger starke Legitimationsfunktion<br />
zuzuordnen. In besonderer Weise trifft dies auf Rankings<br />
und Ratings sowie auf Akkreditierungsverfahren zu.<br />
Im Fall der Akkreditierung geht dies konform mit einer starken<br />
Gewichtung der Kontrollfunktion, die nicht zuletzt<br />
durch die gegenwärtige Lesart der Systemakkreditierung<br />
und der damit verbundenen Entkoppelung von Beratung<br />
und Bewertung sowie der nicht gestuften Akkreditierungsentscheidungen<br />
an Bedeutung zugenommen hat. Gerade<br />
die Möglichkeit einer Akkreditierung mit Auflagen im Rahmen<br />
der Programmakkreditierung gab im Vergleich hierzu<br />
die Möglichkeit Grundsatzbewertungen auszusprechen,<br />
gleichzeitig aber Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen.<br />
Eine Kontrollfunktion ist bei allen übrigen Instrumenten<br />
und Verfahren – sieht man von Absolventenbefragungen<br />
ab, die in erster Linie eine Vergewisserung im Hinblick auf<br />
Employability und Bindung der Studierenden an die Hochschule<br />
bieten – auf einem mittleren Niveau gegeben.<br />
Eine Entwicklungsfunktion lässt sich vor allem in Peer Review-Verfahren,<br />
die in der Mehrzahl der Fälle – nicht zuletzt<br />
im Rahmen von internen und externen Evaluationen –<br />
einen beratenden Charakter haben, sowie bzgl. Studienverlaufsanalysen<br />
feststellen. Akkreditierungsverfahren wie<br />
auch Lehrveranstaltungsbefragungen sind zwar grundsätzlich<br />
geeignet Entwicklungen anzustoßen, werden in der<br />
Praxis allerdings selten in den Kontext einer kontinuierlichen<br />
Qualitätsentwicklung gestellt. So ist die systematische<br />
Abbildung 2: Funktionen von Qualitätssicherungsverfahren<br />
<strong>QiW</strong> 1+2/2009<br />
5