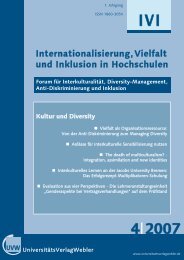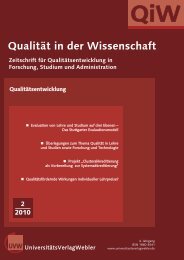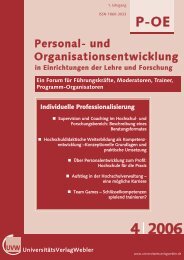QiW - UniversitätsVerlagWebler
QiW - UniversitätsVerlagWebler
QiW - UniversitätsVerlagWebler
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>QiW</strong><br />
R. Krempkow • Von Zielen zu Indikatoren – Versuch einer Operationalisierung für Lehre ...<br />
desto geringer ist dieser Wert (vgl. Lenz u.a. 2006, S. 50;<br />
KMK 2005, S. 6; zur Aussagekraft bereits frühzeitig Webler<br />
u.a. 1993).<br />
b) Studierbarkeit aus Zeit-Perspektive - bezogen auf Absolventen:<br />
Diese kann als Studienzeitüberschreitung erfasst<br />
werden, gemessen an der durchschnittlichen Anzahl der<br />
Fachsemester bis zum erfolgreichen Abschluss, die über<br />
die Regelstudienzeit hinaus studiert wurden (für den aktuellen<br />
Absolventenjahrgang). Fachwechsel haben dabei<br />
keinen Einfluss. Zur Erklärung möglicher Ursachen einer<br />
größeren/kleineren Studienzeitüberschreitung können<br />
insbes. Absolventenbefragungen einen Beitrag leisten.<br />
Erst Absolventen können das komplette Studium rückblickend<br />
bewerten. Zudem können bestimmte Aspekte<br />
durch Studierendenbefragungen kaum erfasst werden,<br />
wie z.B. Probleme bei der Organisation von Abschlussprüfungen<br />
und Wiederholungsmöglichkeiten (vgl. Daniel<br />
1996, Krempkow/Bischof 2009).<br />
Alternativ könnte der Anteil der Studienabschlüsse in<br />
der Regelstudienzeit (in %) verwendet werden bzw. Die<br />
mittlere Fachstudiendauer (vgl. WR 2008, S. 21; BfS<br />
2008; Lenz u.a. 2006, S. 48; KMK 2005). Letztere ist<br />
aber für BA/MA schwer vergleichbar.<br />
c) Studierbarkeit aus Leistungs-Perspektive - bezogen auf<br />
Absolventen: Notendurchschnitt in Abschlussprüfungen<br />
(Noten 1 bis 4, nur bestandene) gilt als Indikator für die<br />
gängige Notenvergabepraxis (vgl. Lenz u.a. 2006, S. 51;<br />
Schenker-Wicki 1996). Die Prüfungserfolgsquote wurde<br />
wegen geringer Aussagekraft nicht dargestellt (vgl.<br />
Krempkow 2007, S. 131).<br />
d) Studierbarkeit aus Leistungs-Perspektive - bezogen auf<br />
Absolventen und Studienanfänger: Absolventenquote ist<br />
das Verhältnis der aktuellen Absolventenzahl zur Studienanfängerzahl<br />
(Saldo), gemessen über den Zeitraum<br />
der durchschnittlichen Studiendauer (gerundet auf ganze<br />
Jahre, z.B. 6 Jahre an Universitäten). Hierbei sollten die<br />
Ergebnisse als Mittelwert über die jeweils letzten 2 Jahre<br />
ausgewiesen werden, um zufällige Schwankungen auszugleichen<br />
(vgl. OECD 2008, S. 101; von der OECD wird<br />
dies in ähnlichem Zusammenhang als Erfolgsquote (engl.<br />
completion rate) bezeichnet und vom Schweizerischen<br />
Bundesamt für Statistik (BfS) wird in ähnlicher Weise<br />
eine Studienerfolgsquote berechnet, BfS 2008 4 , Lenz<br />
u.a. 2006, S. 53; zu internationalen Erfahrungen auch<br />
Leszcensky u.a. 2004, S. 18). Mit Absolventenquoten<br />
bzw. Schwundbilanzen (vgl. auch WR 2008, S. 19f.) sind<br />
keine Aussagen über Studienabbrüche, Hochschul- und<br />
Fachwechsel möglich. Dies sollen im Aufbau befindliche<br />
Studienverlaufsanalysen leisten (vgl. Pixner u.a. 2009). 5<br />
2.1.3 Indikatoren zur Studierbarkeit als Prozessqualität<br />
a-d) Studierbarkeit aus Studierenden-Perspektive – subjektive<br />
Wahrnehmungen: Einschätzungen zu Studienbedingungen,<br />
Lehrqualität und Bibliothekssituation als<br />
wichtige Indikatoren der Studienqualität sollten prozessnah<br />
durch Befragungen von Studenten erhoben<br />
werden. Es könnten im ersten Auswertungsschritt vorhandene<br />
Ergebnisse hochschuleigener Befragungen<br />
(vgl. Schüpbach u.a. 2007) und/oder Befragungsergebnisse<br />
des CHE-Hochschulrankings verwendet werden,<br />
wobei die Werte Notenurteilen entsprechen (vgl. CHE<br />
2008). Es konnte bislang davon ausgegangen werden,<br />
dass sich die Studiensituation innerhalb von wenigen<br />
Jahren nicht grundlegend verändert und damit die verfügbaren<br />
Befragungsergebnisse (letzte drei Jahre vom<br />
jeweils aktuellen CHE-Studienführer) auch die Situation<br />
in den Jahren zuvor im Wesentlichen zutreffend<br />
beschreiben (zumal sich die Urteile der Studierenden<br />
auch auf die zuvor erlebte Situation in ihrem Studium<br />
beziehen). Empirische Belege für diese Annahme liefern<br />
Zeitvergleiche über mehrere Jahre bei studentischen<br />
Lehrbewertungen (auch unter Einbeziehung von<br />
Rahmenbedingungen des Studiums – vgl. z.B. Rindermann<br />
2001, Krempkow/Winter 2000, Krempkow<br />
2003) sowie die Zeitvergleiche, die das CHE für „Aufsteiger“<br />
und „Absteiger“ vornimmt und die in sehr wenigen<br />
Fällen grundlegende Veränderungen ausweisen<br />
(siehe www.che.de).<br />
In weiteren Schritten sollten hochschuleigene Befragungen<br />
auch die Kompetenzförderung einbeziehen<br />
(vgl. Lenz u.a. 2006, Braun u.a. 2006, siehe URL:<br />
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/<br />
15/ 06/key/ind1.approach.101.html).<br />
e) Studierbarkeit aus Anonymitätspotential-Perspektive -<br />
bezogen auf Studierende: Studentenzahlen (Mehrjahresmittel)<br />
können als Prozessindikator für das Anonymitätspotential<br />
eines Studienganges während der gesamten<br />
Studienzeit einer gedachten Studierendenkohorte dienen.<br />
Sie sollen z.B. in etwa erfassen, mit wie vielen anderen<br />
Studierenden man sich einen Platz in der Fachbibliothek<br />
o. ä. theoretisch teilen muss. Sie sollten sich auf das<br />
grundständiges Präsenzstudium beziehen (ohne Aufbauoder<br />
Fernstudium). Das Mehrjahresmittel wurde berechnet,<br />
um ein Maß für die durchschnittliche Anzahl der<br />
Studierenden im gesamten zu betrachtenden Zeitraum<br />
von Studienanfängern (Jahrgänge entspr. Absolventenquoten)<br />
bis zum aktuellsten Absolventenjahrgang zu erhalten<br />
(vgl. BfS 2008; Lenz u.a. 2006, S. 46; zu internationalen<br />
Erfahrungen vgl. Leszcensky u.a.2004, S. 189).<br />
2.1.4 Studierbarkeit als Ressourcenqualität/Ausgangsbedingungen<br />
(Input)<br />
a) Quantitative Ressourcen – bezogen auf Anonymitätspotential<br />
für Anfängerkohorte: Studienanfängerzahlen beziehen<br />
sich auf das reguläre Studium (1. Fachsemester,<br />
grundständiges Präsenzstudium), enthalten also kein<br />
Aufbau- oder Fernstudium. Sie sollen z.B. in etwa erfassen,<br />
mit wie vielen anderen Studierenden man sich einen<br />
Platz in Einführungskurs, Grundlagenvorlesung o.ä. theoretisch<br />
teilen muss (vgl. BfS 2008; WR 2008, S. 20, Lenz<br />
u.a. 2006, S. 46, zu Erstjahresstudenten in Finnland/Niederlande<br />
vgl. Leszcensky u.a.2004, S. 189).<br />
b) Qualitative Ressourcen – bezogen auf das Leistungspotential:<br />
Abiturnote erfasst die Durchschnittsnote im zum<br />
Hochschulzugang berechtigenden Zeugnis für die Absolventen<br />
des untersuchten Prüfungsjahrganges, hilfsweise<br />
für Jahrgänge aus der Absolventenquotenberechnung<br />
4 Vgl. ausführlicher: Braun, E. (2007): Das Berliner Evaluationsinstrument für<br />
selbsteingeschätzte studentische Kompetenzen – BEvaKomp. Göttingen.<br />
5 Dies könnte im Prozessmodell den Ausgangsbedingungen zugeordnet<br />
werden (vgl. Krempkow u.a. 2008, S. 7).<br />
<strong>QiW</strong> 1+2/2009<br />
47