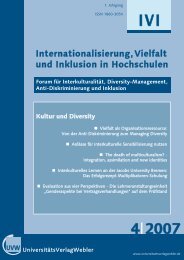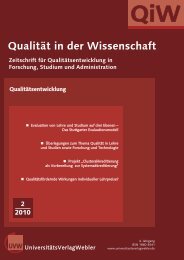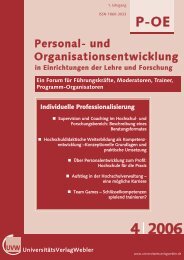QiW - UniversitätsVerlagWebler
QiW - UniversitätsVerlagWebler
QiW - UniversitätsVerlagWebler
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>QiW</strong><br />
K. Hauss & M. Kaulisch • Diskussion gewandelter Zusammenhänge zwischen Promotion, ...<br />
nale Promotionsprogramm (IPP), die Max-Planck-Gesellschaft<br />
(MPG) betreibt mit Hochschulen zusammen gegenwärtig<br />
mehr als 55 International Max Planck Research<br />
Schools, die Hans-Böckler-Stiftung richtet Promotionskollegs<br />
ein, einzelne Bundesländer (Niedersachsen, Nordrhein<br />
Westfalen, Bayern und Bremen) fördern den Ausbau von<br />
Graduate Schools, Forschungsschulen und Ähnlichem, Universitäten<br />
bieten ihren Promovierenden zunehmend strukturierte<br />
Promotionsstudiengänge an und durch die Exzellenzinitiative<br />
des Bundes und der Länder werden gegenwärtig<br />
strukturierte Promotionsprogramme zu aktuell 39<br />
Graduiertenschulen zusammengefasst, die jeweils mit<br />
durchschnittlich 1 Mio. Euro pro Jahr gefördert werden<br />
(DFG 2008). Neben dem wachsenden Angebot an strukturierten<br />
Promotionsformen entstehen neue Strukturen, wie<br />
z.B. Graduiertenakademien oder -zentren, die als Koordinationsstellen<br />
oder Schirmorganisationen Weiterbildungs-,<br />
Förder-, Beratungs-, Coaching-, und Unterstützungsangebote<br />
sowie spezielle Mentoringprogramme für Promovierende<br />
anbieten. Die Graduiertenschulen, die im Rahmen<br />
der Exzellenzinitiative gefördert werden, sind teilweise Hybride,<br />
die strukturierte, themenzentrierte Doktorandenausbildung<br />
mit Strukturen und Angeboten von Graduiertenakademien<br />
kombinieren (vgl. Sondermann/Simon/<br />
Scholz/Hornbostel 2008).<br />
2. Die Promotion zwischen Ausbildung,<br />
Forschung und Beschäftigung<br />
Die Universität als jener Ort, an dem die Promotion zwar<br />
nicht notwendigerweise erarbeitet, so doch de jure abgelegt<br />
werden muss, partizipiert als Organisation gleichwertig<br />
an zwei Funktionssystemen – Wissenschaft und Erziehung,<br />
deren Verknüpfung in der klassischen deutschen Universitätstheorie<br />
die Gestalt der Einheit von Forschung und<br />
Lehre annahm (vgl. Stichweh 1994). In dem sie die Grenze<br />
zwischen Forschung und Lehre auflöst, kann die Promotion<br />
somit einerseits als Ausbildungsprozess innerhalb des universitären<br />
Ausbildungssystems (Erziehungssystem im Luhmann'schen<br />
Sinne), andererseits als Beginn einer Forscherlaufbahn<br />
im Wissenschaftssystem aufgefasst werden.<br />
Gleichzeitig findet sie mehrheitlich auf Mitarbeiterstellen<br />
(vgl. Berning/Falk 2006) innerhalb des Beschäftigungssystems<br />
statt. An diesen Schnittstellen lassen sich die beobachtbaren<br />
Veränderungen in der Doktorandenausbildung<br />
als Ergebnis oder Teilprozess von Veränderungen innerhalb<br />
der einzelnen Funktionssysteme aufgreifen (vgl. Abbildung<br />
1). Wir möchten im Folgenden hierzu einige Überlegungen<br />
anstellen und konzentrieren uns auf die Wandlungsprozesse<br />
in der Doktorandenausbildung und im Wissenschaftssystem.<br />
Auf der Folie dieser Wandlungsprozesse diskutieren<br />
wir Veränderungen in den Karrierebedingungen in der Wissenschaft.<br />
2.1 Welche Veränderungen können in der Doktorandenausbildung<br />
beobachtet werden?<br />
Mit der Einführung strukturierter Promotionsangebote entstehen<br />
formalisierte Verfahren, die zum Teil schriftlich in Betreuungsvereinbarungen,<br />
Promotionsvereinbarungen, o.ä.<br />
festgehalten werden und Verpflichtungen sowohl auf Seiten<br />
der Promovierenden, als auch der Betreuenden generieren,<br />
Abbildung 1: Promotion im Wandel zwischen universitärem<br />
Ausbildungssystem, Forschungs-, und Beschäftigungssystem<br />
die es in der Form in der traditionellen Doktorandenausbildung<br />
nicht gegeben hat. Die DFG veröffentlichte hierzu<br />
kürzlich Empfehlungen für das Erstellen von Betreuungsvereinbarungen<br />
(DFG 2008). Üblicherweise beinhalten die Betreuungsvereinbarungen<br />
Regelungen über die zu erreichenden<br />
Ziele der Promotion, die Bearbeitungsdauer sowie Aufgaben<br />
und zu erbringende Leistungen der Promovierenden.<br />
Während über Wirkung und Qualität der Betreuung im angelsächsischen<br />
Raum vergleichsweise viel bekannt ist (vgl.<br />
Brown/Atkins 1988; Latona/Browne 2001; Murphy/Bain/<br />
Conrad 2007) beschränken sich systematische Analysen<br />
hierzulande auf wenige qualitative Studien (vgl. Engler<br />
2003). Offen ist bislang z.B. welche Wirkung von der Betreuungsleistung<br />
und ihrer vertraglichen Fixierung auf den<br />
Promotionsverlauf ausgeht, und welche Rolle dabei Form,<br />
Intensität und persönliche Erwartungshaltungen spielen.<br />
Weiteres Merkmal der strukturierten Form der Promotion<br />
ist die verpflichtende Teilnahme an einem Kursprogramm.<br />
Dieses basiert i.d.R. auf einem Punktesystem und beinhaltet<br />
neben fachlichen Kursen auch ein außerfachliches Qualifikationsangebot<br />
(Schlüsselkompetenzen). Die Einführung<br />
eines verpflichtenden Kursprogramms im Spannungsfeld<br />
zwischen „Verschulung“ der Doktorandenausbildung und<br />
traditioneller „learning-on-the-job“-Doktorandenausbildung<br />
ist dabei immer wieder kritisch diskutiert worden.<br />
Während letzteres eher Praxiselemente der wissenschaftlichen<br />
Ausbildung betont und somit unterschiedliche Forschungs-<br />
und Arbeitspraxen in den verschiedenen Disziplinen<br />
zulässt, sind Inhalte eines Kursprogramms eher als Vorbereitung<br />
auf konkrete Forschungsarbeit zu sehen (vgl.<br />
Hornbostel 2009, Schipp 2006). Aufgrund der unterschiedlichen<br />
Organisation der Doktorandenausbildung in den einzelnen<br />
Fächern wurde Kritik insbesondere aus den Reihen<br />
solcher Fachrichtungen laut, deren Ausbildungskonzepte<br />
traditionell wenig Spielraum für verpflichtende Kursangebote<br />
vorsehen (z.B. die Ingenieurswissenschaften).<br />
Die Eingliederung der Promotionsphase in die gestufte Studienstruktur,<br />
wie sie im Bologna-Prozess angedacht ist,<br />
<strong>QiW</strong> 1+2/2009<br />
23