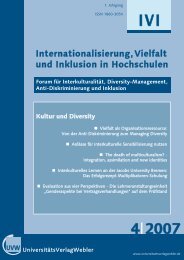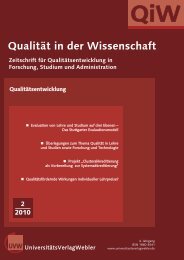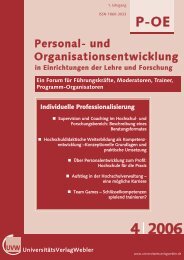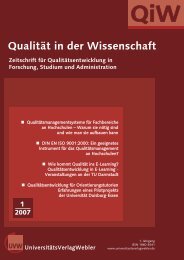QiW - UniversitätsVerlagWebler
QiW - UniversitätsVerlagWebler
QiW - UniversitätsVerlagWebler
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>QiW</strong><br />
W.-D. Webler • „Wieviel Wissenschaft braucht die Evaluation?”<br />
Zu 3. Autonome Forschung, Auftragsforschung?<br />
Zeitweise wurde von Seiten der Verwaltung eingewandt,<br />
bei den Projekten handele es sich um keine Forschung, da<br />
sie einen Auftraggeber habe. Jede Form von Auftragsforschung<br />
hat aber einen Auftraggeber, ohne dass jemand bisher<br />
aus diesem Grund Zweifel am Forschungscharakter von<br />
Auftragsforschungen angemeldet hätte. Offensichtlich gibt<br />
es auch Nebentätigkeit, die das Kriterium von Forschung<br />
erfüllt; das wird in der Literatur nicht angezweifelt; jede<br />
Nebentätigkeit hat aber einen Auftraggeber. Für die Frage,<br />
ob Forschung vorliegt, ist unerheblich, ob der Erkenntnisprozess<br />
aufgrund der persönlichen Erkenntnisinteressen<br />
der Forscher oder der Interessen einer anderen Instanz (z.B.<br />
der von einer möglichen Entwicklung Betroffenen oder der<br />
Bildungspolitik) durchgeführt wird. Ebenso unerheblich ist<br />
die Frage, von welcher Seite die Finanzierung erfolgt: ob<br />
mit Hilfe der „normalen“ Ausstattung einer Forschungseinrichtung,<br />
einer projektspezifischen Förderung und dort<br />
wieder, ob aufgrund einer mäzenatenhaften, an dem Ergebnis<br />
nicht unmittelbar (etwa aufgrund von Verwertungsinteressen)<br />
interessierten Förderung oder einem immateriellen<br />
(z.B. politischen, öffentlichen) oder materiellen (z.B. in<br />
eine Produktion mündenden) Verwertungsinteresse. Eng<br />
damit verknüpft ist die Frage, ob die Forschung aufgrund<br />
eigener freier Entscheidung der Forscher (die frei nur sein<br />
kann, wenn unspezifische Forschungsmittel ausreichend<br />
zur Verfügung stehen) oder aufgrund eines Forschungsauftrags<br />
zustande kommt.<br />
Schon die heute innerwissenschaftlich übliche Stellung<br />
eines Förderantrags, seine Prüfung und die Zusage der Förderung<br />
erfüllt die Merkmale eines Vertrages. Dieser ist eine<br />
zweiseitige Willenserklärung bzw. einseitige Willenserklärung<br />
und deren Annahme. Aber Forschung ist nicht vom<br />
Kriterium innerwissenschaftlicher Förderung abhängig.<br />
Wissenschaft ist öffentlich vielfach aufgefordert, neue, externe<br />
Formen der Finanzierung zu finden (z.B. Sponsoring),<br />
in denen sich - so wird erklärt - auch die gesellschaftliche,<br />
öffentliche oder private Wertschätzung dokumentiere bzw.<br />
die Legitimation dieser Forschung erhöhe. Evaluationsforschung<br />
als die wissenschaftliche Kontrolle eines sozialen<br />
Experiments hat immer Auftraggeber, da entweder der Zugang<br />
zum Untersuchungsfeld von Genehmigungen abhängt<br />
(besonders in der Schulevaluation) oder ohne explizite Zustimmung<br />
der Betroffenen (die sogar in einer Einladung zu<br />
der Untersuchung gipfeln kann) nicht möglich ist, wie regelmäßig<br />
im Hochschulbereich. Evaluationsforschung ist<br />
also immer Auftragsforschung, selbst wenn der Auftraggeber<br />
nicht die Finanzierung übernimmt. Charakteristika der<br />
Auftragsforschung sind:<br />
• Wunsch des Auftraggebers nach einem (verwertbaren)<br />
Ergebnis; er will nicht mäzenatenhaft „Forschung als<br />
Tätigkeit oder als Vermehrung von Wissenschaft“ finanzieren,<br />
sondern erhofft ganz konkret ein in seinem Kontext<br />
anwendungsfähiges Ergebnis.<br />
• Am Ende fast aller Forschungsberichte steht ein Werk.<br />
Ein Bericht, ein Buch ist in diesem Sinne ein Werk. Viele<br />
Forschungsfördervereinbarungen, z.B. mit Ministerien,<br />
enthalten die Pflicht zur Ablieferung eines Werkes.<br />
• Abgeliefert wird ein Forschungsbericht, der dann regelmäßig<br />
auch als Gutachten bezeichnet werden kann,<br />
wenn er eine untersuchte Situation bewertet und sich<br />
z.B. als Ergebnis der Evaluation eines Schulversuches<br />
über die Bewährung eines bestimmten Musters von Modellschule<br />
äußert.<br />
Der Landesgesetzgeber NRW ist im Hochschulgesetz vom<br />
14. März 2000 (§ 101) bei der Forschung mit Mitteln Dritter<br />
selbstverständlich vom Vorhandensein von Erwartungen<br />
des Förderers ausgegangen - zumindest von den im Forschungsantrag<br />
regelmäßig in Aussicht gestellten Ergebnissen<br />
(mindestens: die Schließung einer bestimmten, relativ<br />
genau beschriebenen Erkenntnislücke). Die Tatsache, dass<br />
der Förderer Erwartungen an die Ergebnisse des Forschungsprojekts<br />
hat, beseitigt nicht den Charakter der Forschung.<br />
Er bindet auch die Verwendung seiner Fördermittel<br />
an eng bestimmte Zwecke, nämlich die im Antrag beschriebenen.<br />
Absatz 4 Satz 2 des § 101 lautet: „Die Mittel sind<br />
für den von der oder dem Dritten bestimmten Zweck zu<br />
verwenden und nach deren oder dessen Bedingungen zu<br />
bewirtschaften, soweit gesetzliche Bestimmungen nicht<br />
entgegenstehen.“<br />
Zu 4. Vertraulichkeit der (Einzel-)ergebnisse mit dem Auftraggeber<br />
vereinbart<br />
In § 100 des nordrhein-westfälischen Hochschulgesetzes<br />
vom 14. März 2000heißt es in Absatz 2 Satz 1 sehr zurückhaltend:<br />
„Die Ergebnisse von Forschungsvorhaben sollen in<br />
absehbarer Zeit nach Durchführung des Vorhabens veröffentlicht<br />
werden.“ Bei der Forschung mit Mitteln Dritter<br />
wird die Forderung sogar noch weiter zurückgenommen. In<br />
§ 101 Abs. 2, 2. Halbsatz heißt es: „die Forschungsergebnisse<br />
sind in der Regel in absehbarer Zeit zu veröffentlichen.“<br />
(Hervorhebung v. Verf.). Diese Formulierungen sind<br />
verständlich, da es bei Auftragsforschung aus Gründen des<br />
Wettbewerbs inopportun sein kann, dem Wettbewerber<br />
die Ergebnisse in Fachpublikationen zur eigenen Verwertung<br />
frei Haus zu liefern. Im Fall der Evaluation von Hochschuleinrichtungen<br />
besteht angesichts des Wettbewerbs<br />
mit gleichartigen Einrichtungen sowohl innerhalb wie<br />
außerhalb der Hochschule um gleiche Ressourcen ein starkes<br />
Interesse an Vertraulichkeit der Ergebnisse. Besonders<br />
bei erstmaliger Evaluation von Lehre und Studium sind die<br />
Ergebnisse in der Regel so wenig brillant, dass die Einrichtungen<br />
bei Modellen erfolgsorientierter Mittelverteilung<br />
innerhalb der Hochschule oder auf Landesebene Ressourceneinbußen<br />
befürchten müssen. Sie wollen unter dem<br />
Schutz der Vertraulichkeit zunächst einmal die Chance<br />
haben, „ihr Haus in Ordnung zu bringen“, bevor - z.B. bei<br />
neuen Evaluationsverfahren - die Ergebnisse veröffentlicht<br />
werden. Ein solches Interesse ist zu respektieren - insbesondere,<br />
wenn die Evaluation freiwillig eingegangen wurde<br />
- weil anderenfalls von vornherein schon die Entstehung<br />
und Erzeugung sensibler Daten verhindert und das ganze<br />
Verfahren unkritisch zu einer Alibiveranstaltung herabsinken<br />
würde, wie es inzwischen in einer Reihe von Fällen eingetreten<br />
ist.<br />
Ein Argument gegen den Status als Forschung ist die Vereinbarung<br />
von Vertraulichkeit über die Einzeldaten nicht.<br />
Im übrigen hat der Leiter der Projektgruppe sich regelmäßig<br />
vertraglich zusichern lassen, die Daten anonymisiert<br />
und aggregiert im Wege der Sekundäranalyse der allgemeinen<br />
Hochschulforschung zuführen zu dürfen.<br />
<strong>QiW</strong> 1+2/2009<br />
31